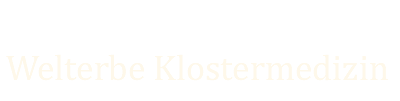Test Showlist
Achillea millefolium - Gemeine Schafgarbe 4.jpg
Adonis vernalis - Adonisroeschen 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Adonis vernalis - Adonisroeschen 1.jpg
Agrostemma githago - Kornrade 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Agrostemma githago - Kornrade 1.jpg
Agrostemma githago - Kornrade 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Agrostemma githago - Kornrade 2.jpg
Alcea rosea - Stockrose 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Alcea rosea - Stockrose 1.jpg
Aloe vera - Curacao-Aloe 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Aloe vera - Curacao-Aloe 1.jpg
Anthemis altissima 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Anthemis altissima 1.jpg
Anthemis tinctoria - Foerber-Kamille 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Anthemis tinctoria - Foerber-Kamille 2.jpg
Aquilegia vulgaris - Akelei 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Aquilegia vulgaris - Akelei 2.jpg
Aquilegia vulgaris - Akelei 3.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Aquilegia vulgaris - Akelei 3.jpg
Arachis hypogaea - Erdnuss 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Arachis hypogaea - Erdnuss 2.jpg
Atropa bella-donna - Tollkirsche 7.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Atropa bella-donna - Tollkirsche 7.jpg
Brassica oleracea ssp. capitata var. capitata f. rubra - Rotkohl 1.jpg
Calendula officinalis - Garten-Ringelblume 4.jpg
Centaurea cyanus - Kornblume 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Centaurea cyanus - Kornblume 1.jpg
Centaurea cyanus - Kornblume 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Centaurea cyanus - Kornblume 2.jpg
Centaurium erythraea - Echtes Tausendgueldenkraut 3.jpg
Cerinthe minor - Kleine Wachsblume 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Cerinthe minor - Kleine Wachsblume 1.jpg
Chamomilla recutita - Echte Kamille 3.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Chamomilla recutita - Echte Kamille 3.jpg
Cichorium intybus ssp. sativus var. foliosum - Chicoree 1.jpg
Cistus ladanifer - Lack-Zistrose 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Cistus ladanifer - Lack-Zistrose 1.jpg
Citrus limon - Zitrone 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Citrus limon - Zitrone 1.jpg
Citrus limon - Zitrone 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Citrus limon - Zitrone 2.jpg
Coffea arabica - Kaffeestrauch 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Coffea arabica - Kaffeestrauch 1.jpg
Conium maculatum - Gefleckter Schierling 5.jpg
Convallaria majalis - Maigloeckchen 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Convallaria majalis - Maigloeckchen 1.jpg
Convallaria majalis - Maigloeckchen 3.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Convallaria majalis - Maigloeckchen 3.jpg
Coriandrum sativum - Koriander 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Coriandrum sativum - Koriander 2.jpg
Corydalis bulbosa - Hohler Lerchensporn 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Corydalis bulbosa - Hohler Lerchensporn 1.jpg
Crataegus laevigata - Zweigriffeliger Weissdorn 1.jpg
Cydonia oblonga var. maliformis - Quitte Apfelform 2.jpg
Datura metel - Arabischer Stechapfel 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Datura metel - Arabischer Stechapfel 2.jpg
Dianthus carthusianorum - Karthaeuser-Nelke 1.jpg
Dicentra spectabilis - Traenendes Herz 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Dicentra spectabilis - Traenendes Herz 1.jpg
Echinaceae purpurea - Rote Kegelblume 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Echinaceae purpurea - Rote Kegelblume 1.jpg
Equisetum palustre - Sumpf-Schachtelhalm 1.jpg
Euonymus europaeus - Pfaffenhuetchen 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Euonymus europaeus - Pfaffenhuetchen 1.jpg
Euphorbia serrata - Gesaegte Wolfsmilch 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Euphorbia serrata - Gesaegte Wolfsmilch 1.jpg
Fragaria vesca - Wald-Erdbeere 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Fragaria vesca - Wald-Erdbeere 2.jpg
Frangula alnus - Faulbaum 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Frangula alnus - Faulbaum 1.jpg
Frangula alnus - Faulbaum 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Frangula alnus - Faulbaum 2.jpg
Galium odoratum - Waldmeister 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Galium odoratum - Waldmeister 1.jpg
Galium odoratum - Waldmeister 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Galium odoratum - Waldmeister 2.jpg
Galium verum - Echtes Labkraut 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Galium verum - Echtes Labkraut 2.jpg
Gaultheria procumbens - Wintergruen 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Gaultheria procumbens - Wintergruen 1.jpg
Geranium sanguineum - Blut-Storchschnabel 1.jpg
Ginkgo biloba - Ginkgo 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Ginkgo biloba - Ginkgo 1.jpg
Grindelia robusta - Grindelkraut 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Grindelia robusta - Grindelkraut 1.jpg
Grindelia robusta - Grindelkraut 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Grindelia robusta - Grindelkraut 2.jpg
Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 1.jpg
Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 2.jpg
Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 3.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 3.jpg
Helleborus viridis - Gruene Nieswurz 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Helleborus viridis - Gruene Nieswurz 1.jpg
Heracleum sphondylium - Wiesenbaerenklau 1.jpg
Hieracium aurantiacum - Orangerotes Habichtskraut 1.jpg
Hieracium lanatum - Wolliges Habichtskraut 1.jpg
Hippophae rhamnoides - Sanddorn 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Hippophae rhamnoides - Sanddorn 1.jpg
Humulus lupulus - Hopfen 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Humulus lupulus - Hopfen 1.jpg
Juglans regia - Echte Walnuss 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Juglans regia - Echte Walnuss 2.jpg
Laurus nobilis - Lorbeer 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Laurus nobilis - Lorbeer 1.jpg
Leucanthemum vulgare - Margerite 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Leucanthemum vulgare - Margerite 1.jpg
Lysimachia nummularia - Pfennigkraut 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Lysimachia nummularia - Pfennigkraut 1.jpg
Melissa officinalis - Melisse 4.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Melissa officinalis - Melisse 4.jpg
Mentha aquatica - Bachminze 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Mentha aquatica - Bachminze 1.jpg
Mentha piperita - Echte Pfefferminze 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Mentha piperita - Echte Pfefferminze 1.jpg
Mentha piperita - Echte Pfefferminze 8.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Mentha piperita - Echte Pfefferminze 8.jpg
Nymphaea - Seerose 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Nymphaea - Seerose 2.jpg
Paeonia officinalis - Pfingstrose 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Paeonia officinalis - Pfingstrose 2.jpg
Prunus dulcis - Mandelbaum 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Prunus dulcis - Mandelbaum 1.jpg
Pulmonaria officinalis - Lungenkraut 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Pulmonaria officinalis - Lungenkraut 1.jpg
Pulsatilla vulgaris - Kuhschelle 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Pulsatilla vulgaris - Kuhschelle 1.jpg
Punica granatum - Granatapfel 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Punica granatum - Granatapfel 1.jpg
Ranunculus acris - Scharfer Hahnenfuss 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Ranunculus acris - Scharfer Hahnenfuss 1.jpg
Rauvolfia serpentina - Indische Schlangenwurzel 1.jpg
Rauvolfia serpentina - Indische Schlangenwurzel 2.jpg
Rubus fruticosus - Echte Brombeere 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Rubus fruticosus - Echte Brombeere 1.jpg
Ruta graveolens - Weinraute 3.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Ruta graveolens - Weinraute 3.jpg
Salvia officinalis - Echter Salbei 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Salvia officinalis - Echter Salbei 1.jpg
Sempervivum tectorum - Dachwurz 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Sempervivum tectorum - Dachwurz 1.jpg
Silene coronaria - Kronen-Lichtnelke 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Silene coronaria - Kronen-Lichtnelke 1.jpg
Silybum marianum - Mariendistel 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Silybum marianum - Mariendistel 2.jpg
Silybum marianum - Mariendistel 4.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Silybum marianum - Mariendistel 4.jpg
Silybum marianum - Mariendistel 5.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Silybum marianum - Mariendistel 5.jpg
Solanum melongena - Aubergine 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Solanum melongena - Aubergine 2.jpg
Tagetes patula - Studentenblume 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Tagetes patula - Studentenblume 1.jpg
Tanacetum cinerariifolium - Dalmatinische Insektenblume 1.jpg
Theobroma cacao - Kakao 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Theobroma cacao - Kakao 1.jpg
Tropaeolum majus - Grosse Kapuzinerkresse 1.jpg
Tropaeolum majus - Grosse Kapuzinerkresse 2.jpg
Rosa centifolia - Zentfolie Kohlrose 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Rosa centifolia - Zentfolie Kohlrose 1.jpg
Was erzählt die Vita über Hildegard als Heilerin?
Liber III der Vita Hildegards und Medizin
Das letzte Buch der Vita sanctae Hildegardis bietet in 27 Kapiteln Wundererzählungen, in denen reale körperliche und seelische Leiden benannt werden, die Heilung aber ausschließlich durch Gebet, Vision, Reliquienkontakt und Exorzismus geschieht. Die folgende Fallübersicht zeigt, dass der Text damit keine medizinischen Therapien im Sinne von Causae et curae oder Physica überliefert und keinen Beitrag zur Rekonstruktion einer ärztlichen Praxis Hildegards leistet.
Fallübersicht
III 1: Eine adlige junge Frau im Konvent leidet an tertianem Fieber (Drei-Tage Fieber), das sich mit den üblichen, im Text nicht näher benannten remedia nicht bessert. Entscheidend wird erst Hildegards Handauflegung mit Segensworten; das Fieber weicht unmittelbar. Aus medizinhistorischer Sicht bleibt die eigentliche Therapie vollständig im Raum der hagiographischen Wundertopik, während mögliche Arzneimittel oder diätetische Maßnahmen unerwähnt bleiben.
III 2: Der Mönch Roricus wird von derselben tertiana geplagt. Wiederum schildert der Text keinen schrittweisen Heilverlauf, keine Aderlässe, keine diätetische Kur, sondern eine abrupte Besserung nach Hildegards Gebet und segnender Geste. Die Heilung dient primär als Beleg der „curationum gratia“ der Heiligen, nicht als Fallvignette medizinischer Therapie.
III 3: Eine Magd des Klosters hat einen auffälligen Tumor am Hals, der von den Umstehenden als ernstes Leiden wahrgenommen wird. Die Vita berichtet weder Diagnoseüberlegungen noch eine konkrete Behandlung im Sinn einer Salbe, eines Pflasters oder eines chirurgischen Eingriffs, sondern lediglich Berührung und Segen durch Hildegard, worauf der Tumor schwindet. Die körperliche Pathologie wird so zum bloßen Träger eines Wunders.
III 4: Ein Schwabe aus Thalfingen kommt nach langer Reise mit generalisierten Schwellungen des ganzen Körpers an den Rupertsberg. Beschrieben wird eine fromme Aufnahme im Kloster, Hildegards persönliche Zuwendung, Berührung und Segenshandlung. Weder Ursachen noch naturkundliche Erklärungsversuche werden erwähnt, und es fehlen alle Elemente einer längerfristigen kurativen Behandlung; der Text konzentriert sich auf die plötzliche Wiederherstellung der „pristina incolumitas“.
III 5: Der sieben Monate alte Simon aus Rüdesheim leidet an heftigen Zuckungen aller Glieder, die gut als frühkindliche Krampfleiden lesbar sind. Anstelle von Beobachtung, Einordnung oder vorsichtiger Prognose setzt der Text ein einziges kausales Moment: die Fürbitte Hildegards und die Heilung „nach Gottes Willen“. Von einer kindermedizinischen Intervention ist keine Rede.
III 6: Ein Mann namens Arnold aus Wackernheim mit so starken Halsschmerzen, dass ihm das Atmen schwerfällt, sendet eine Bitte an Hildegard. Sie segnet aus der Ferne Wasser und lässt es ihm bringen; nach dem Trinken weicht der Schmerz. Auch hier fungiert Wasser nicht als pharmakologisch qualifizierte Arznei, sondern als Träger von Segenskraft; eine differenzierte Therapieentscheidung ist nicht erkennbar.
III 7: Die Tochter der Hazecha aus Bingen ist drei Tage lang stumm und offensichtlich lebensgefährlich erkrankt. Die Mutter erhält von Hildegard nur geweihtes Wasser; nach der Einnahme stellt sich schlagartig Stimme und Kraft der Tochter wieder ein. Der Text verzichtet auf jede nähere Beschreibung von Verlauf, Pflege oder Behandlung und rahmt die Genesung ausschließlich als Erfolg der heiligen Fürbitte.
III 8: Ein junger Mann im selben Ort ringt mit dem Tod. Die Intervention wiederholt das Muster aus Fall 7: von Hildegard gesegnetes Wasser, das dem Kranken gereicht wird, woraufhin er „in extremis agens“ zur Gesundheit zurückkehrt. Eine medizinische Logik – etwa Dosis, Dauer, ergänzende Maßnahmen – wird nicht entwickelt; entscheidend ist allein der Kontakt zur Heiligen.
III 9: Ein Mädchen wird als in „maßloser Liebe“ zu einem Jüngling entbrannt beschrieben, also mit einer Mischung aus moralischer und psychischer Entgleisung. Geheilt wird sie durch Brot von Hildegards Tisch, das als geweihtes Objekt fungiert. Der Text deutet weder eine seelische Therapie im heutigen Sinn an, noch eine naturkundliche Beeinflussung von Körperzuständen; die „Krankheit“ ist primär moralisch codiert und wird sakramental behandelt.
III 10: Eine Frau Sibilla aus Lausanne leidet unter anhaltendem Blutfluss, der in der Kapitelliste ausdrücklich erwähnt wird. Hildegard sendet ihr einen Brief; im Zuge dieser schriftlich vermittelten geistlichen Kommunikation versiegt die Blutung. Aus medizinhistorischer Perspektive ist auffällig, dass bei einem so klassischen gynäkologisch-humoralmedizinischen Problem keinerlei Pflanzen, Diäten oder blutstillende Verfahren genannt werden, sondern der Text allein auf Wort- und Gnadeneffekt setzt.
III 11: Allgemein wird berichtet, dass Partikel von Hildegards Haaren und Kleidungsstücken, die Kranken aufgelegt werden, Heilung bringen. Einzelbeispiel ist die Frau des Bingener Schultheißen, die unter schweren, sich hinziehenden Geburtswehen leidet; nach dem Umgürten mit einem von den Nonnen übersandten Haarzopf wird die Geburt erleichtert. Der Vorgang ist klar als Verwendung von Kontaktreliquien beschrieben, nicht als Einsatz eines medizinischen Instruments oder pharmakologischen Mittels.
III 12: Zwei weitere Frauen mit ähnlichen Beschwerden – langwierige Geburten oder gynäkologische Leiden – werden mit demselben Haarzopf gegürtet und erfahren Befreiung von ihren Schmerzen. Wiederum liegt der Fokus auf der überpersönlichen Wirkkraft des heiligen Körpers, nicht auf individueller Diagnose oder maßgeschneiderter Therapie.
III 13: Zwei vom Wahnsinn befallene Frauen kehren zu klarem Verstand zurück, nachdem sie mit Hildegards Haarzopf gegürtet wurden. Das seelische Leiden erscheint nicht als Gegenstand ärztlicher Beobachtung oder eines therapeutischen Gespräches, sondern als Störzustand, der durch physische Nähe zu reliquienhaft verstandenen Haaren aufgehoben wird.
III 14: Der junge Rudolf aus Ederich wird in einer Nachtvision von Hildegard vor einem feindlichen Überfall gewarnt und entkommt so der Lebensgefahr. Medizinisch ist dieser Fall nur indirekt relevant: Krankheit tritt nicht auf, sondern wird narrativ durch prophetische Intervention verhindert. Der Text schärft hier das Profil Hildegards als Seherin, nicht als Heilerin.
III 15: Ein schwer kranker Ritter liegt im Sterben und erlebt im Traum, wie Hildegard ihm die Hand auflegt; unmittelbar darauf erhebt er sich und ist gesund. Die Vita bietet keine andere Erklärung als diese visionäre Handauflegung. Weder Pflegepraktiken noch ärztliche Maßnahmen werden erwähnt; der Fall dient ausschließlich der Demonstration von Hildegards wunderwirkender Präsenz.
III 16: Ein Priester findet rätselhafte Buchstaben auf der Altardecke und ist über sein eigenes Fehlverhalten erschüttert. Hildegards Deutung dieser Zeichen führt zu seiner Besserung und zum Eintritt ins Kloster. Krankheit tritt hier nur in Form moralisch-seelischer Verirrung auf; statt Therapie im medizinischen Sinn bietet der Text eine exemplarische Bußgeschichte.
III 17: Hildegards Predigtreisen nach Köln, Trier, Metz, Würzburg, Bamberg und in zahlreiche Klöster werden zusammenfassend geschildert. Sie verkündet das Wort Gottes und mahnt zur Umkehr. Ein unmittelbarer Krankheitsbezug fehlt; für die Medizingeschichte ist wichtig, dass ihre Autorität ausdrücklich in der Rolle einer Prophetin und Lehrerin, nicht in der einer praktizierenden Medizinerin präsentiert wird.
III 18: Auf einer Rheinfahrt bei Rüdesheim bringt eine Frau einen blinden Knaben zum Schiff und bittet um Hilfe. Hildegard schöpft Wasser aus dem Fluss, segnet es und benetzt damit die Augen des Kindes; dessen Sehvermögen kehrt zurück. Wasser ist hier reines Medium göttlicher Gnade, nicht als Arznei mit bestimmten Qualitäten charakterisiert; weder Diagnose des Augenleidens noch Behandlung im humoralmedizinischen Raster werden versucht.
III 19: Ein Mann leidet heftig an der „fallenden Sucht“ (Epilepsie). Nach einer segnenden Bekreuzigung durch Hildegard wird er anfallsfrei; als er das wunderbare Geschehen daheim publik macht, kommen zahlreiche andere Epileptiker zu ihr und kehren geheilt zurück. Die Vita nutzt Epilepsie als dankbaren Demonstrationsfall für unmittelbare Wunderheilung, ohne einen Zusammenhang mit damaligen therapeutischen Praktiken herzustellen.
III 20: In einem längeren Komplex beschreibt die Vita eine adlige Frau, die seit Jahren von einem Dämon geplagt ist. Hildegard reflektiert ausführlich die „fumositas“ und Schwärze des Teufels, seine Wirkweise in Körper und Seele, und entwirft ein elaboriertes Szenario der Austreibung, in dem Gebete, Fasten, Almosen und liturgische Riten zusammenwirken. Die Besessenheit ist als geistlich-dämonologisches, nicht als psychiatrisches oder neurologisches Problem gefasst; medizinische Überlegungen treten vollständig zurück hinter die Theologie des Bösen.
III 21: Briefe von Abt und Brüdern der betroffenen Frau an Hildegard werden referiert. Sie bitten um Rat zur Austreibung des Dämonen und betonen ihre eigene Erfolglosigkeit trotz intensiver geistlicher Bemühungen. Hildegards schriftliche Antwort enthält detaillierte liturgische Anweisungen für sieben Priester mit Stäben in der Hand; die gesamte Argumentation bleibt auf der Ebene der Sakrallogik und Exorzismuspraxis, nicht auf der eines Heilverfahrens im medizinischen Sinne.
III 22: Nach sieben Jahren der Bedrängnis wird die besessene Frau schließlich auf den Rupertsberg gebracht. In der Osternacht und am Karsamstag kulminieren die geschilderten geistlichen Bemühungen, bis der unreine Geist unter dramatischen Begleiterscheinungen – inklusive gewaltsamer Ausscheidungen – ausfährt und die Frau an Leib und Seele gesund zurückbleibt. Der Ablauf ist bewusst als Exorzismuswunder inszeniert; eine alternative Deutung als psychosomatischer oder psychiatrischer Heilprozess wird vom Text nicht angedeutet.
III 23: Hildegard selbst berichtet in der Ich-Form von einer schweren, vierzig Tage andauernden Krankheit, die sie in Todesnähe bringt. Die Beschreibung bedient sich meteorologischer Metaphorik („heiße Winde“, „wasserführender Wind“), ohne naturkundliche Diagnostik zu leisten. Eine Wendung zum Besseren tritt ein, als sie – dem göttlichen Auftrag folgend – das Wort Gottes zu bestimmten Klerikern trägt; Linderung und Heilung werden so direkt an prophetischen Gehorsam geknüpft, nicht an irgendeine medizinische Intervention.
III 24: In einer nachfolgenden Vision sieht Hildegard einen wunderbaren Jüngling, der alle Krankheiten und Dämonen von ihr vertreibt. Der Text markiert damit explizit, dass ihre Genesung als Christuswirkung verstanden werden soll. Für eine „Therapiegeschichte“ im engeren Sinn ist dieser Fall nur insofern relevant, als er die Radikalität des geistlich-christologischen Deutungsrahmens vor Augen führt.
III 25: Auf eindringliche Bitte ihres Abtes und der Brüder verfasst Hildegard das Leben des heiligen Disibod, wie es ihr in der Vision gezeigt wurde. Medizinische Aspekte treten hier nicht in Erscheinung; aus medizinhistorischer Sicht ist bedeutsam, dass ihre schriftstellerische Tätigkeit als Gehorsamsleistung und Visionsempfang, nicht als fachliche Autorentätigkeit im Sinn eines „Medizinbuches“ dargestellt wird.
III 26: Die Vita betont, dass Hildegard das „Buch der göttlichen Werke“ und zahlreiche weitere Schriften hinterlassen habe und außerdem fünf Besessene befreite. Die Kombination von Schriftproduktion und Exorzismen schärft ihr Profil als Prophetin und charismatische Heilerin. Ein systematischer medizinischer Diskurs – etwa zu Kräutern, Diäten oder Körperfunktionen – wird wiederum nicht aufgenommen.
III 27: Abschließend schildert die Vita Hildegards „glücklichen Heimgang“ und die Zeichen an ihrem Sterbebett: Lichterscheinungen, Düfte, erste posthume Heilungen an ihrem Grab. Krankheit und Tod erscheinen hier nur als Durchgangsstation in den Heiligkeitsstatus, nicht als Gegenstand ärztlichen Handelns. Die spätere Krankenheilung geschieht über Reliquienkontakt und Anrufung ihres Namens, ohne jede Spur einer konkreten, therapeutisch begründeten Intervention.
In der Zusammenschau zeigt die Fallserie von Liber III, dass körperliche und seelische Leiden zwar detailliert genug benannt werden, um als realistische Krankheitsbilder erkennbar zu sein, die Heilungen selbst aber konsequent durch Gebet, Vision, Kontaktreliquien und Exorzismus getragen werden. Die Vita nutzt Krankheit als Bühne für Heiligkeit; für Hildegards Rolle als „Medizinerin“ im engeren Sinn sind daher Causae et curae und die naturkundlichen Passagen der Physica die entscheidenden Texte, nicht die Mirakel der Vita.
Medizinhistorische Einordnung und Konsequenzen
Aus medizinhistorischer Perspektive ist zunächst festzuhalten, dass Liber III in seiner Gesamtkonzeption eindeutig der Gattung der Mirakelbücher verpflichtet ist. Die einzelnen Vignetten folgen einem stabilen erzählerischen Schema: geschildertes Leiden, Zuspitzung der Notlage, Hinwendung zu Hildegard, punktuelle Intervention mit geistlich-symbolischen Mitteln (Segenswort, Wasser, Brot, Haarzopf, Exorzismus), anschließende schlagartige Heilung und abschließende Danksagung. Dieses Schema dient weniger der dokumentierenden Beschreibung von Krankheitsverläufen als der Inszenierung von Heiligkeit und göttlicher Gnade.
Die Fallübersicht macht deutlich, dass selbst dort, wo relativ präzise Krankheitsbegriffe auftauchen – tertiana, „fallende Sucht“, Blutfluss, langwierige Geburtswehen, Wahnsinn –, keine Entfaltung eines naturkundlich-therapeutischen Diskurses erfolgt. Weder werden differenzierende Diagnosen gestellt, noch tauchen Kriterien der Prognostik, der humoralmedizinischen Einordnung oder der Indikationsstellung für bestimmte Medikamente auf. Pflanzen, Drogen, komplexe Rezepturen oder Regimina spielen in Liber III schlicht keine Rolle; das „Heilmittel“ ist die Heilige selbst, sei es in physischer Präsenz, als Vision oder in Form von Reliquienkontakt.
Damit unterscheidet sich Liber III in Struktur und Argumentation grundlegend von Causae et curae und den medizinisch relevanten Teilen der Physica. Dort werden Beschwerden und Krankheiten in ein erklärendes Gefüge von Säften, Temperamenten, Körperregionen und Lebensordnungen gestellt; es werden konkrete Pflanzennamen, Zubereitungsformen, Dosierungsangaben und Kombinationen genannt. Die Vision fungiert in diesen Traktaten als Legitimationshorizont, nicht als Ort des Heilgeschehens selbst. Liber III dagegen verschiebt die Aufmerksamkeit von der Frage nach „richtiger“ Therapie auf die Frage nach der Glaubwürdigkeit und Wirkmacht der Heiligen.
Für die Beurteilung von Hildegards Stellung in der Medizingeschichte hat dies mehrere Konsequenzen. Erstens lässt sich aus den Wundergeschichten des dritten Buches keine eigenständige „Heilpraxis“ im Sinne einer alltäglichen ärztlichen Tätigkeit rekonstruieren. Hildegard erscheint hier nicht als praktische Ärztin, die Diagnosen stellt und Arzneien verordnet, sondern als charismatische Fürbitterin, deren körperliche und symbolische Nähe Heilung vermittelt. Zweitens sind die Krankheitsbezeichnungen funktional auf den Beweischarakter des Wunders hin gebaut: je schwerer und aussichtsloser das Leiden, desto eindrucksvoller die Heilung. Drittens bietet Liber III reiches Material für Kult-, Frömmigkeits- und Sozialgeschichte der Kranken, aber nur sehr begrenzt für eine Geschichte der Therapieformen.
Gerade im Blick auf moderne Konstruktionen einer „Hildegard-Medizin“ ist dieser Befund nicht trivial. Die Mirakel des Liber III zeigen, wie Hildegard in ihrer Gemeinschaft und in der regionalen Umgebung als Heilige wahrgenommen und verehrt wurde – sie begründen jedoch keine naturheilkundliche Schule und liefern keine Legitimation für konkrete Rezepttraditionen. Wer sich für Hildegards Beitrag zur vormodernen Medizin interessiert, muss daher streng zwischen dem hagiographischen Zeugnis der Vita und den medizinisch-naturkundlichen Werken unterscheiden. Die Fallanalyse von Liber III schärft diese Grenze und verhindert, dass Wundererzählungen nachträglich in den Rang impliziter ärztlicher Praxis erhoben werden.
Letzte Änderungen
- Der Ingwer stärkt das Gedächtnis: Zu Ingwer in der arabischen Medizin
- Yngwer vermischet in die kost ist fast gůt: Ingwer im "Gart der Gesundheit" (1485)
- Ingwer und zweimal so viel Galgant und halb so viel Zitwer: Ingwergewächse bei Hildegard von Bingen
- Presseschau zum Ingwer (Arzneipflanze des Jahres 2026)
- Ingwer ist Arzneipflanze des Jahres 2026
- Walahfrid Strabo: Leben und Werk
- Arzneipflanze des Jahres 2026: Ingwer - Zingiber officinale
- Flüsse und Blüten: Menstruation, weibliche Physiologie und sexuelle Begierde bei Trota von Salerno und Hildegard von Bingen
- Sara von Würzburg und Ortolfs Arzneibuch
- Synthese frühmittelalterlicher Medizin- und Wissenskulturen: Forschungsstand zur Revision des „finsteren Mittelalters“
- Das Zerrbild der Klostermedizin: Von der konfessionellen Polemik zur modernen Forschung
- Warum war das Bild zur Epoche der Klostermedizin so lange schief und ist es zum Teil bis heute?
- Was erzählt die Vita über Hildegard als Heilerin?
- Hildegard von Bingen, Mondfinsternis und das Eruptionscluster 1108–1110
- Presseschau zur Schafgarbe (Arzneipflanze des Jahres 2025)
- Arzneikürbis - Cucurbita pepo L., Cucurbitaceae
- Publikationen zu Autoren & Werken
- Publikationen zur Klostermedizin
- Publikationen zu Pflanzen
- Aktuelles und Termine
- Knoblauch - Allium sativum L., Alliaceae
- Andorn - Marrubium vulgare L., Lamiaceae
- Angelika - Angelica archangelica L., Apiaceae
- Apfelbeere - Aronia MEDIK., Rosaceae
- Sesam - Sesamum indicum L., Pedaliaceae
- Rosen - Rosa-Arten: Rosa gallica L., Rosa centifolia L., Rosa canina L.
- Weißdorn - Crataegus monogyna JACQ.; Crataegus laevigata (POIR.) DC.; Crataegus nigra WALDST. & KIT.
- Mariendistel - Silybum marianum (L.) GAERTNER, Asteraceae
- Lorbeer - Laurus nobilis L., Lauraceae
- Rizinus - Ricinus communis L., Euphorbiaceae
- Arnika - Arnica montana L., Asteraceae
- Ginkgo - Ginkgo biloba L., Ginkgoaceae
- Eukalyptusbaum - Eucalyptus globulus LABILL., Myrtaceae
- Schöllkraut - Chelidonium majus L., Papaveraceae
- Myrte – Myrtus communis, Myrtaceae
- Gewürzsumach - Rhus aromatica AIT., Anacardiaceae
- Borretsch - Borago officinalis L., Boraginaceae
- Keuschlamm oder Mönchspfeffer - Vitex agnus-castus L., Lamiaceae
- Schafgarbe - Achillea millefolium L., Asteraceae
- Beinwell - Symphytum officinale L., Boraginaceae
- Huflattich - Tussilago farfara L., Asteraceae
- Sägepalme - Serenoa repens (BARTR.) SMALL, Arecaceae
- Johanniskraut - Hypericum perforatum L., Hypericaceae
- Presseschau zur Blutwurz (Arzneipflanze des Jahres 2024)
- Pfefferminze - Mentha x piperita L., Lamiaceae
- Alant - Inula helenium L., Asteraceae
- Acker-Schachtelhalm oder Zinnkraut - Equisetum arvense L.
- Aus dem Alltag eines Medizinhistorikers
- Hat Hildegard von Bingen kolloidales Silber empfohlen?
- Woher bekommt man verlässliche Informationen zur Pflanzenheilkunde?
- Literatur
- Arzneipflanze des Jahres 2025: Gemeine Schafgarbe - Achillea millefolium
- Arzneipflanze des Jahres 2024: Blutwurz - Potentilla erecta
- Die Mitglieder
- “Drink before breakfast and vomit”: Zur Geschichte von Hamamelis in Amerika und Europa
- Arzneipflanze des Jahres 2023: Echter Salbei - Salvia officinalis
- Presseschau zum Echten Salbei (Arzneipflanze des Jahres 2023)
- Neues Supermittel: Weg mit Kokos, her mit Ginseng!
- Supermondfinsternis
- Presseschau zum Mönchspfeffer (Arzneipflanze des Jahres 2022)
- Arzneipflanze des Jahres 2022: Mönchspfeffer, Keuschlamm - Vitex agnus-castus
- Fasten (21): Fasten bei Hildegard von Bingen
- Goethe und das Coffein
- Presseschau zum Myrrhenbaum (Arzneipflanze des Jahres 2021)
- Impressum
- Arzneipflanze des Jahres 2021: Myrrhenbaum - Commiphora myrrha
- Deutsches Arzneibuch 6 und Ergänzungsbuch 6
- Kann man sich gegen Infektionen schützen?
- Kontakt
- Fortbildung
- Neuer Ausbildungskurs Klostermedizin und Phytotherapie
- Presseschau zum Lavendel (Arzneipflanze des Jahres 2020)
- Arzneipflanze des Jahres 2020: Echter Lavendel - Lavandula angustifolia
- Weihnachtsgewürze
- Fasten (31): Die Wurzeln des modernen Heilfastens
- Zum 838. Todestag von Hildegard von Bingen
- Presseschau zum Weißdorn (Arzneipflanze des Jahres 2019)
- Immenblatt - Weiße Taubnessel - Zitronenmelisse: Eine Verwechslungsgeschichte über Jahrtausende
- Wir hatten uns doch noch so viel vorgenommen...
- Senföle bekämpfen bakterielle Erreger auf mehreren Ebenen
- Förderung der pankreatischen Restfunktion bei EPI-Patienten durch Rizoenzyme aus Reispilzen
- Feinstaub ohne Feinsinn?
- Zur Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt
- Von tatsächlichen und angeblichen Krebsmitteln aus der Natur
- Erkältungskrankheiten umfassend therapieren: Über den Einsatz von Senfölen und Bitterstoffen
- Buchtipp: Pflanzliche Arzneimittel - was wirklich hilft
- A View to a Kill? Im Angesicht des Todes?
- Mikronährstoffe zwischen Nutzen und Risiko
- Ätherische Öle bei Lyme-Borreliose: Laborstudie deutet auf gute Wirksamkeit verschiedener pflanzlicher Öle hin
- Vorträge in Kooperation mit dem Bund Naturschutz
- Arzneipflanze des Jahres 2019: Weißdorn - Crataegus
- Zum Begriff Naturheilkunde, gängigen Strömungen und zur Abgrenzung des Begriffes
- Die Forschergruppe im ZDF ("Terra X: Drogen – Eine Weltgeschichte")
- Neue internationale Meta-Analyse bestätigt: Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich wirken natürlich gegen Krankheitserreger
- Überlebenschancen nach "alternativer" Krebsbehandlung
- Naturheilkunde in der Krebstherapie
- Themenheft Klostermedizin der "Deutschen Heilpraktiker-Zeitschrift"
- Novartis stoppt Antibiotika-Entwicklung: Pflanzliche Alternativen jetzt noch wichtiger
- Antibakterielle Wirkung von ätherischen Ölen verschiedener Lippenblütler
- Fasten: Ein wiederentdeckter Weg zu Wohlbefinden und seelischem Gleichgewicht