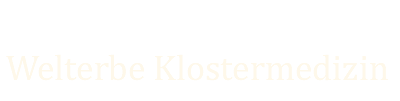Test Showlist
Achillea millefolium - Gemeine Schafgarbe 4.jpg
Adonis vernalis - Adonisroeschen 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Adonis vernalis - Adonisroeschen 1.jpg
Agrostemma githago - Kornrade 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Agrostemma githago - Kornrade 1.jpg
Agrostemma githago - Kornrade 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Agrostemma githago - Kornrade 2.jpg
Alcea rosea - Stockrose 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Alcea rosea - Stockrose 1.jpg
Aloe vera - Curacao-Aloe 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Aloe vera - Curacao-Aloe 1.jpg
Anthemis altissima 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Anthemis altissima 1.jpg
Anthemis tinctoria - Foerber-Kamille 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Anthemis tinctoria - Foerber-Kamille 2.jpg
Aquilegia vulgaris - Akelei 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Aquilegia vulgaris - Akelei 2.jpg
Aquilegia vulgaris - Akelei 3.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Aquilegia vulgaris - Akelei 3.jpg
Arachis hypogaea - Erdnuss 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Arachis hypogaea - Erdnuss 2.jpg
Atropa bella-donna - Tollkirsche 7.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Atropa bella-donna - Tollkirsche 7.jpg
Brassica oleracea ssp. capitata var. capitata f. rubra - Rotkohl 1.jpg
Calendula officinalis - Garten-Ringelblume 4.jpg
Centaurea cyanus - Kornblume 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Centaurea cyanus - Kornblume 1.jpg
Centaurea cyanus - Kornblume 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Centaurea cyanus - Kornblume 2.jpg
Centaurium erythraea - Echtes Tausendgueldenkraut 3.jpg
Cerinthe minor - Kleine Wachsblume 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Cerinthe minor - Kleine Wachsblume 1.jpg
Chamomilla recutita - Echte Kamille 3.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Chamomilla recutita - Echte Kamille 3.jpg
Cichorium intybus ssp. sativus var. foliosum - Chicoree 1.jpg
Cistus ladanifer - Lack-Zistrose 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Cistus ladanifer - Lack-Zistrose 1.jpg
Citrus limon - Zitrone 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Citrus limon - Zitrone 1.jpg
Citrus limon - Zitrone 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Citrus limon - Zitrone 2.jpg
Coffea arabica - Kaffeestrauch 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Coffea arabica - Kaffeestrauch 1.jpg
Conium maculatum - Gefleckter Schierling 5.jpg
Convallaria majalis - Maigloeckchen 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Convallaria majalis - Maigloeckchen 1.jpg
Convallaria majalis - Maigloeckchen 3.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Convallaria majalis - Maigloeckchen 3.jpg
Coriandrum sativum - Koriander 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Coriandrum sativum - Koriander 2.jpg
Corydalis bulbosa - Hohler Lerchensporn 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Corydalis bulbosa - Hohler Lerchensporn 1.jpg
Crataegus laevigata - Zweigriffeliger Weissdorn 1.jpg
Cydonia oblonga var. maliformis - Quitte Apfelform 2.jpg
Datura metel - Arabischer Stechapfel 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Datura metel - Arabischer Stechapfel 2.jpg
Dianthus carthusianorum - Karthaeuser-Nelke 1.jpg
Dicentra spectabilis - Traenendes Herz 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Dicentra spectabilis - Traenendes Herz 1.jpg
Echinaceae purpurea - Rote Kegelblume 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Echinaceae purpurea - Rote Kegelblume 1.jpg
Equisetum palustre - Sumpf-Schachtelhalm 1.jpg
Euonymus europaeus - Pfaffenhuetchen 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Euonymus europaeus - Pfaffenhuetchen 1.jpg
Euphorbia serrata - Gesaegte Wolfsmilch 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Euphorbia serrata - Gesaegte Wolfsmilch 1.jpg
Fragaria vesca - Wald-Erdbeere 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Fragaria vesca - Wald-Erdbeere 2.jpg
Frangula alnus - Faulbaum 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Frangula alnus - Faulbaum 1.jpg
Frangula alnus - Faulbaum 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Frangula alnus - Faulbaum 2.jpg
Galium odoratum - Waldmeister 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Galium odoratum - Waldmeister 1.jpg
Galium odoratum - Waldmeister 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Galium odoratum - Waldmeister 2.jpg
Galium verum - Echtes Labkraut 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Galium verum - Echtes Labkraut 2.jpg
Gaultheria procumbens - Wintergruen 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Gaultheria procumbens - Wintergruen 1.jpg
Geranium sanguineum - Blut-Storchschnabel 1.jpg
Ginkgo biloba - Ginkgo 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Ginkgo biloba - Ginkgo 1.jpg
Grindelia robusta - Grindelkraut 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Grindelia robusta - Grindelkraut 1.jpg
Grindelia robusta - Grindelkraut 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Grindelia robusta - Grindelkraut 2.jpg
Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 1.jpg
Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 2.jpg
Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 3.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 3.jpg
Helleborus viridis - Gruene Nieswurz 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Helleborus viridis - Gruene Nieswurz 1.jpg
Heracleum sphondylium - Wiesenbaerenklau 1.jpg
Hieracium aurantiacum - Orangerotes Habichtskraut 1.jpg
Hieracium lanatum - Wolliges Habichtskraut 1.jpg
Hippophae rhamnoides - Sanddorn 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Hippophae rhamnoides - Sanddorn 1.jpg
Humulus lupulus - Hopfen 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Humulus lupulus - Hopfen 1.jpg
Juglans regia - Echte Walnuss 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Juglans regia - Echte Walnuss 2.jpg
Laurus nobilis - Lorbeer 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Laurus nobilis - Lorbeer 1.jpg
Leucanthemum vulgare - Margerite 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Leucanthemum vulgare - Margerite 1.jpg
Lysimachia nummularia - Pfennigkraut 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Lysimachia nummularia - Pfennigkraut 1.jpg
Melissa officinalis - Melisse 4.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Melissa officinalis - Melisse 4.jpg
Mentha aquatica - Bachminze 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Mentha aquatica - Bachminze 1.jpg
Mentha piperita - Echte Pfefferminze 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Mentha piperita - Echte Pfefferminze 1.jpg
Mentha piperita - Echte Pfefferminze 8.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Mentha piperita - Echte Pfefferminze 8.jpg
Nymphaea - Seerose 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Nymphaea - Seerose 2.jpg
Paeonia officinalis - Pfingstrose 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Paeonia officinalis - Pfingstrose 2.jpg
Prunus dulcis - Mandelbaum 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Prunus dulcis - Mandelbaum 1.jpg
Pulmonaria officinalis - Lungenkraut 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Pulmonaria officinalis - Lungenkraut 1.jpg
Pulsatilla vulgaris - Kuhschelle 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Pulsatilla vulgaris - Kuhschelle 1.jpg
Punica granatum - Granatapfel 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Punica granatum - Granatapfel 1.jpg
Ranunculus acris - Scharfer Hahnenfuss 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Ranunculus acris - Scharfer Hahnenfuss 1.jpg
Rauvolfia serpentina - Indische Schlangenwurzel 1.jpg
Rauvolfia serpentina - Indische Schlangenwurzel 2.jpg
Rubus fruticosus - Echte Brombeere 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Rubus fruticosus - Echte Brombeere 1.jpg
Ruta graveolens - Weinraute 3.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Ruta graveolens - Weinraute 3.jpg
Salvia officinalis - Echter Salbei 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Salvia officinalis - Echter Salbei 1.jpg
Sempervivum tectorum - Dachwurz 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Sempervivum tectorum - Dachwurz 1.jpg
Silene coronaria - Kronen-Lichtnelke 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Silene coronaria - Kronen-Lichtnelke 1.jpg
Silybum marianum - Mariendistel 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Silybum marianum - Mariendistel 2.jpg
Silybum marianum - Mariendistel 4.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Silybum marianum - Mariendistel 4.jpg
Silybum marianum - Mariendistel 5.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Silybum marianum - Mariendistel 5.jpg
Solanum melongena - Aubergine 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Solanum melongena - Aubergine 2.jpg
Tagetes patula - Studentenblume 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Tagetes patula - Studentenblume 1.jpg
Tanacetum cinerariifolium - Dalmatinische Insektenblume 1.jpg
Theobroma cacao - Kakao 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Theobroma cacao - Kakao 1.jpg
Tropaeolum majus - Grosse Kapuzinerkresse 1.jpg
Tropaeolum majus - Grosse Kapuzinerkresse 2.jpg
Rosa centifolia - Zentfolie Kohlrose 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Rosa centifolia - Zentfolie Kohlrose 1.jpg
Warum war das Bild zur Epoche der Klostermedizin so lange schief und ist es zum Teil bis heute?
Einleitung
Das schiefe Bild der „Klostermedizin“ ist nicht zufällig entstanden. Es geht auf mehrere Schichten von Deutungen zurück: auf konfessionelle Polemik seit der Reformation, nationale Sinnstiftungen des 19. Jahrhunderts, Fortschrittserzählungen der Medizingeschichte um 1900 und politisch-moralische Zuspitzungen im 20. Jahrhundert. Wer heute noch von „tausend Jahren Stillstand“, vom „finsteren Mittelalter“ oder von einer „medizinfeindlichen Kirche“ spricht, greift auf genau diese tradierten Schablonen zurück.
16. Jahrhundert
Bereits die „Väter der Botanik“ im 16. Jahrhundert arbeiteten daran, das „katholische Mittelalter“ als Gegenbild zur eigenen gelehrten Identität abzustempeln. Sie schrieben nicht nur über Pflanzen, sondern immer auch über Konfession und Autorität. Hieronymus Bock, als lutherischer Pfarrer im säkularisierten Stift Hornbach tätig, attackierte in Predigten und Satiren die vorreformatorischen Klosterverhältnisse (Niedenthal/Uehleke/Puchtler 2022) und konnte sich im Kapitel zum Mönchspfeffer den Spott über die Mönche nicht verkneifen; der Witz funktioniert nur, weil „Mönch“ und „katholisch“ längst als Projektionsfläche für Lächerlichkeit und Mitleid etabliert waren. Leonhart Fuchs wiederum trennte an der Universität Tübingen scharf zwischen „echter“ antiker Autorität und den arabisch-lateinischen Vermittlungstraditionen, die er pauschal verdächtigte und aus dem akademischen Kanon herausdrängen wollte; programmatisch forderte er, die „Araber“ in der medizinischen Lehre ganz zu verwerfen und zu den griechischen Quellen zurückzukehren (Fuchs 1555; Siraisi 1987; Pormann/Savage-Smith 2007).
In diesen Kreisen setzte sich die Vorstellung durch, arabische und „papistische“ Autoren hätten die antike Medizin verfälscht: Sie galten als Abschreiber, Verdunkler oder gar als bewusste Entsteller der reinen Lehre von Hippokrates und Galen. Was nicht in dieses Schema passte, wurde übergangen – und damit auch reale fachliche Fortschritte, die in der arabisch-islamischen Medizin und ihrer lateinischen Rezeption tatsächlich stattgefunden hatten, etwa in der Augenheilkunde (Hunayn ibn Ishaq, ʿAlī ibn ʿĪsā), der Gynäkologie und Geburtshilfe (Avicenna, al-Zahrawī; im lateinischen Westen Trota von Salerno bzw. das „Trotula“-Ensemble) oder in Form neuer Überlegungen zum Blutkreislauf (Ibn al-Nafīs und, in der lateinischen Tradition, Michael Servet). Differenziertere Diagnostik von Augenkrankheiten, verbesserte operative Techniken, genauere Beschreibungen weiblicher Anatomie und neue Modelle der Blutzirkulation hätten das Bild der „Zwischenzeit“ erheblich komplizierter gemacht, störten aber die einfache Erzählung von der verfälschten Antike (Siraisi 1987; Pormann/Savage-Smith 2007; Schacht 1957).
Hier zeichnet sich zugleich ein weiteres Motiv ab, das später zum Gemeinplatz wird: die Behauptung, die katholische Kirche habe Medizin und Naturforschung im Grunde abgelehnt. Aus einzelnen kirchenrechtlichen Regelungen und innerklösterlichen Konflikten wurde rückblickend ein umfassendes Verdikt konstruiert: Angeblich habe die Kirche ärztliche Tätigkeit als Eingriff in Gottes Willen verurteilt, Sezierungen aus Glaubensgründen verboten und Mönche von der Krankenversorgung fernhalten wollen. Dass gerade Klöster Hospitäler unterhielten, medizinische Texte kopierten und studierten und sich in der praktischen Krankenpflege engagierten, passte dazu schlecht und wurde entsprechend an den Rand gedrängt.
19. und frühes 20. Jahrhundert
Im 19. Jahrhundert verschiebt sich der Fokus, doch das Ergebnis bleibt ähnlich verzerrt. Nationalbewegungen in Deutschland, Frankreich und England suchten nach „ursprünglichen“ Wurzeln der eigenen Nation, die man lieber heidnisch als christlich hätte. Die Kirche, insbesondere die römisch-katholische, erschien nun als Störfaktor, der diese vermeintlich reinen Ursprünge überdeckt oder zerstört habe. Der Rückgriff auf Tacitus’ Germania und die Inszenierung des Nibelungenlieds gehören hierher: Man stilisierte „die Germanen“ zu einem vorchristlichen Idealvolk, wie es paradigmatisch Jacob Grimm in seiner Deutschen Mythologie entwarf (Grimm 1835), und überging, dass die Germania im 9. Jahrhundert in einer Abtei wie Fulda überliefert wurde und das Nibelungenlied um 1200 in einem klar christlichen, höchstwahrscheinlich klerikalen Umfeld verschriftlicht worden ist.
Für das Bild der Klostermedizin war diese Konstellation verhängnisvoll. Klöster wurden nun nicht mehr nur als konfessionell falsche Orte wahrgenommen, sondern auch als Täter gegenüber einem imaginierten „paganen Naturwissen“ des Volkes. Heilpflanzenkunde und Volksheilkunde erschienen wahlweise als Restbestände heidnischer Weisheit oder als von der Kirche unterdrückte weibliche Praxis. Dass gerade in Klöstern antike und spätantike medizinische Texte abgeschrieben, kommentiert und in neue Kontexte übersetzt wurden – einschließlich vieler Inhalte, die aus arabischen Kompilationen und Kommentaren stammten –, passte schlecht in diese Erzählung und blieb entsprechend lange unterbelichtet.
Parallel dazu etablierten sich populäre Deutungen, die bis heute nachwirken. Wie Rita Voltmer herausgearbeitet hat, trugen Jacob Grimm und Jules Michelet mit ihren Deutungen der Hexenverfolgung als blutige Unterdrückung einer vorchristlichen „Volksreligion“ erheblich zu dem Bild bei, die Kirche – und besonders die katholische – sei Haupttäterin der Prozesse (Voltmer 2006). Im angelsächsischen Raum griff man solche Bilder bereitwillig auf. Washington Irving popularisierte in seiner Kolumbus-Biographie das Bild spätmittelalterlicher Theologen, die an der Kugelgestalt der Erde zweifelten und den Seefahrer vor dem „Absturz“ am Rand der Welt warnten (Irving 1828; Russell 1991). Historisch ist das unbegründet, erzählerisch aber äußerst wirksam: Hier die dumpfe, kirchlich geprägte Vormoderne, dort der geniale Einzelheld, der sich über Autoritäten hinwegsetzt. Dass mittelalterliche Gelehrte sehr wohl mit einer kugelförmigen Erde rechneten, zeigen nicht zuletzt Darstellungen wie der in einer St. Galler Handschrift überlieferte „Notker-Globus“, dessen moderne Nachbildung heute im Stiftsbezirk St. Gallen zu sehen ist.
Im Fahrwasser des Kulturkampfes und der sich etablierenden Medizingeschichte um 1900 wurden diese Motive in gelehrte Form gegossen. Die Erzählung von den „tausend Jahren Stillstand“ zwischen Antike und Renaissance, prominent vertreten etwa von Julius Pagel (1902), der davon sprach, dass „während eines vollen Jahrtausends und noch darüber hinaus Natur- und Heilkunde einen so gut wie gänzlichen Stillstand, eine Stagnation im schlimmsten Wortsinne erfuhren“, machte aus der Vormoderne ein Durchgangstal, das man möglichst rasch hinter sich lassen wollte. Entsprechend vernichtend fiel sein Urteil über die Produkte der „Mönchsmedizin“ aus, die „Samt und sonders [den] Verfall der Wissenschaften in seiner krassesten Form“ dokumentierten.
Gerade in dieser Phase verfestigte sich das Narrativ von der „medizinfeindlichen Kirche“ endgültig. Einzelne Dekrete, etwa zur Rolle der Mönche in der praktischen Heilkunde oder zur Organisation universitärer Ausbildung, wurden zu großflächigen Verboten umgedeutet: Aus Diskussionen über Zuständigkeiten und Professionalisierung wurde rückblickend ein grundsätzlicher Bann gegen Medizin, aus Streitigkeiten zwischen Ärzten, Badern und Ordensleuten eine universale Unterdrückung der Heilkunst durch Rom. In populären Erzählungen vom dramatischen Kampf zwischen Glauben und Wissenschaft diente dann etwa die Hinrichtung des Arztes und Theologen Michael Servet 1553 in Genf – der in einem theologischen Traktat Überlegungen zum Lungenkreislauf formuliert hatte – als scheinbarer Beleg, obwohl es im Prozess um seine antitrinitarische Theologie ging, nicht um seine medizinischen Thesen. Dass gleichzeitig bischöfliche Städte Hospitäler trugen, Orden in der Krankenversorgung tätig blieben und die Universitäten als kirchlich geprägte Institutionen medizinische Fakultäten ausbauten, fiel gerne unter den Tisch.
Spätes 20. Jahrhundert und Gegenwart
Diese teleologische Fortschrittserzählung verband sich im 20. Jahrhundert mit weiteren ideologischen Schichten. Nationalsozialistische Deutungen verstärkten den Gegensatz von „germanischem“ Erbe und „romano-katholischer“ oder „orientalischer“ Überformung und trugen dazu bei, Kloster, Scholastik und arabische Gelehrsamkeit als Fremdkörper in einer vermeintlich „artgemäßen“ Tradition abzustempeln. Exemplarisch ist Himmlers „Hexen-Sonderauftrag“ mit der sogenannten Hexenkartothek, in der die frühneuzeitlichen Prozesse als Verbrechen der Kirche an einem angeblich „germanischen“ Erbe inszeniert werden sollten (Lorenz/Bauer/Behringer/Schmidt 2000). Die neuere Forschung zur Deutungsgeschichte der Hexenverfolgungen – etwa Rita Voltmers Analyse von Jacob Grimm und den modernen Hexen-Mythen (Voltmer 2006) – zeigt, wie eng solche Bilder mit antikatholischen und völkischen Lesarten verschränkt sind. Nach 1945 verschwanden diese Muster nicht einfach, sondern wurden nur anders akzentuiert. In kirchenkritischen und feministischen Kontexten avancierte die Figur der „Hexe“ zur unterdrückten Heilerin, während Kirche und „Schulmedizin“ als Unterdrücker- und Verfolgerbündnis erschienen.
Für die Klostermedizin ergaben sich daraus zwei gegensätzliche, aber gleichermaßen schiefe Bilder. In der einen Variante ist sie Teil des Problems: klerikal, dogmatisch, mitverantwortlich für Hexenverfolgungen und die Unterdrückung „weiblicher“ Heilkunst. In der anderen, seit den 1970er Jahren im Umfeld der modernen Hildegard-Rezeption und des Esoterikmarktes verbreiteten Variante, wird „Klosterheilkunde“ romantisiert: als zeitlose, naturverbundene Gegenmedizin zur kalten Apparatemedizin, je nach Bedarf mit Hildegard, „den Mönchen“ oder einer nebulösen „alten Klosterweisheit“ als Marke. In beiden Fällen geht die historische Komplexität verloren: die reale Verbindung zu gelehrter Medizin, zur Rezeption arabischer Autoren, zur Hospitalorganisation, aber auch zu magischen, liturgischen und litaneihaften Praktiken im therapeutischen Alltag.
Dass diese überzeichneten Bilder so lange überlebten, hat auch mit den Medien der Wissensweitergabe zu tun. Schulbücher und Unterrichtsmaterialien haben lange dazu beigetragen, diese Narrative zu festigen; gerade für das Mittelalter sind Schülervorstellungen von einem „dunklen“, rückständigen Zeitalter bis heute gut belegt (Hamann 2021). Das Motiv eines „dunklen“ oder „stillstehenden“ Mittelalters mit einer rund tausendjährigen Lücke erscheint zudem bis heute in populären Darstellungen und insbesondere in der angloamerikanischen Schul- und Allgemeinliteratur, wie Jeffrey Burton Russell für die Schulbuchgeschichte der „Flat-Earth“-Legende gezeigt hat (Russell 1991). Und in deutschsprachigen Dokumentationen tauchen nach wie vor vertraute Versatzstücke auf: Folterkeller, Scheiterhaufen, „geheimes Klosterwissen“, dramatische Konflikte zwischen Glauben und Wissen – alles, was sich gut bebildern lässt, während Bibliothekskataloge, Überlieferungsgeschichten und Rezeptkompilationen kaum eine Chance auf Sendezeit haben.
Fazit
Die eigentliche Klostermedizin, verstanden als Geflecht aus Texten, Orten, Personen und Praktiken, verschwindet zwischen diesen Extrembildern. Sie ist weder die heldenhafte Alternative zur modernen Medizin noch deren dunkles Gegenbild, weder der Inbegriff dogmatischer Rückständigkeit noch ein zeitloses Naturheilideal, sondern ein historisch konkretes Phänomen: eingebettet in lateinisch-christliche Gelehrsamkeit, die antike, spätantike und arabische Wissensbestände verarbeitete; verankert in liturgischen und spirituellen Kontexten; zugleich aber in der Alltagsversorgung von Kranken, Armen und Reisenden präsent.
Neuere Überblicksstudien zur Medizin der Merowinger- und Karolingerzeit sowie zur Medizin im Umfeld Bedas und zum frühmittelalterlichen England haben diese Komplexität der vormodernen Medizin- und Wissenslandschaften herausgearbeitet (Palmer 2023; Palmer 2024; Palmer 2025; Leja 2016; Leja 2022; Burridge 2019; Röckelein 2023; Batten 2024). Für die Wege antiken medizinischen Wissens in den lateinischen Westen hebt Röckelein (2023, S. 46 f.) unter anderem die Übersetzungen aus dem Griechischen in Ravenna (5.–7. Jh.) und deren Weitergabe über Zentren wie Lucca, Verona, Modena und Mailand (7.–9. Jh.) hervor sowie die Rolle Bobbios und der columbanischen Klöster in Alemannien und Nordgallien (7.–8. Jh.), während Rom und Montecassino eher als Zentren geistlicher Literatur profiliert waren.
Gerade diese Forschung macht sichtbar, dass die seit dem 6. Jahrhundert in Klöstern tradierten, aus heutiger Sicht „abgeschmackten“ spätantiken Kompilationen weniger Ausdruck geistiger Ideenarmut als Reaktion auf strukturelle Engpässe waren. Mit dem weitgehenden Verlust des Griechischen im Westen verengte sich der Zugriff auf die antike Medizin auf wenige lateinische Sammelwerke; die Bestände vieler Bibliotheken bestanden aus fragmentarischen Sammlungen, und Schreibstuben mussten mit knappen Ressourcen haushalten. Vor diesem Hintergrund lag es nahe, kompakte Kompendien wie Pseudo-Apuleius, Marcellus Empiricus oder Cassius Felix immer wieder zu kopieren, während spezialisiertere Literatur verschwand (Palmer 2023).
Hinzu kamen Spannungen zwischen monastischer Lebensform und ärztlicher Profession. Klosterregeln betonten Krankenpflege als Pflicht der caritas, warnten aber gleichzeitig vor einer zu weit gehenden curiositas gegenüber dem Körper und vor einem selbständigen Heilberuf, der mit Reisen, Bezahlung und Prestige verbunden war. Mönchsärzte bewegten sich damit zwischen asketischen Idealen, karitativer Praxis und der Konkurrenz professioneller Ärzte und Bader; Debatten des 9. Jahrhunderts, wie Meg Leja sie rekonstruiert, kreisen genau um diese Grenzziehungen (Leja 2016; Leja 2022).
Schließlich zwingt die materielle und ökologische Situation zur Anpassung. Viele klassische Rezepte setzen Zutaten aus dem mediterranen oder orientalischen Raum voraus, die im poströmischen Gallien oder in England nur schwer zugänglich waren. Klöster experimentierten mit Substitutionen, griffen verstärkt auf heimische Flora zurück und verbanden überlieferte Rezepturen mit lokalen Erfahrungen, eine Dynamik, die sich in den karolingischen Rezeptkompilationen widerspiegelt, die Claire Burridge analysiert (Burridge 2019). Methodisch blieb man zugleich auf einen Mix aus Autorität, Einzelfallbeobachtung und kollektiver Rezeptüberlieferung angewiesen; systematische Sektionen, große klinische Serien oder Labortechnik standen schlicht nicht zur Verfügung.
Dass das Bild bis heute nur langsam geraderückt wird, liegt weniger an der Forschungslage als an der Trägheit kultureller Erzählungen. In der allgemeinen Mittelalterforschung haben sich seit den 1970er Jahren Deutungen durchgesetzt, die die Spätantike und das Frühmittelalter als Transformations- und Verflechtungszonen begreifen; populär verdichtet wurden solche Ansätze in Entwürfen wie The Bright Ages von Matthew Gabriele und David Perry, die die vermeintliche Finsternis durch Geschichten von Vernetztheit und Kontinuität ersetzen (Gabriele/Perry 2021). In der Medizingeschichte schließen Arbeiten zu merowingischer, karolingischer und angelsächsischer Medizin an diese Perspektive an, indem sie Mönchsärzte und Klöster als Akteure in komplexen Wissensnetzwerken behandeln, nicht als Bremsklötze einer linearen Fortschrittsgeschichte.
Fortschrittsmythen, Hexenbilder, nationale Ursprungsfantasien, kirchenkritische Narrative und das bequeme Schema einer „medizinfeindlichen Kirche“ liefern jedoch weiterhin einfache Deutungsangebote, an die neue Medienprodukte anschließen können, ohne sich mit sperrigen Details zu belasten. Wer die Epoche der Klostermedizin historisch verstehen will, muss daher mehrere Schichten gleichzeitig abtragen: die konfessionelle Polemik der Reformationszeit, die nationalen Überhöhungen des 19. Jahrhunderts, die teleologische Medizingeschichtsschreibung um 1900 und die politisch-moralischen Vereinfachungen des 20. Jahrhunderts. Erst dann wird sichtbar, was Klostermedizin historisch tatsächlich war – und warum das Bild so lange so gründlich verzogen blieb.
Literatur
Ältere Deutungen
Bock, Hieronymus: Kreütterbuch. Straßburg 1551.
Fuchs, Leonhart: Institutiones medicinae. Lyon 1555.
Irving, Washington: A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus. New York 1828.
Grimm, Jacob: Deutsche Mythologie. Göttingen 1835.
Neuburger, Max / Julius Pagel (Hg.): Handbuch der Geschichte der Medizin. Bd. 1. Jena 1902, S. 446, 624.
Brecht, Bertolt: Leben des Galilei. Verschiedene Fassungen 1938–1955.
Neuere Forschung
Schacht, Joseph: Ibn al-Nafis, Servetus and Colombo. In: Al-Andalus 22 (1957), 317–336.
Siraisi, Nancy G.: Avicenna in Renaissance Italy. The Canon and Medical Teaching in Italian Universities after 1500. Princeton 1987.
Russell, Jeffrey Burton: Inventing the Flat Earth. Columbus and Modern Historians. Westport 1991.
Lorenz, Sönke / Dieter R. Bauer / Wolfgang Behringer / Jürgen Michael Schmidt (Hg.): Himmlers Hexenkartothek. Das Interesse des Nationalsozialismus an der Hexenverfolgung. Bielefeld 2000.
Voltmer, Rita: Hexenverfolgungen. Vom getrübten Blick auf die frühneuzeitlichen Hexenverfolgungen – Versuch einer Klärung. 2006.
Pormann, Peter E. / Emilie Savage-Smith: Medieval Islamic Medicine. Edinburgh 2007.
Leja, Meg: The Sacred Art: Medicine in the Carolingian Renaissance. Viator 47 (2016), 1–34.
Gabriele, Matthew / David M. Perry: The Bright Ages. A New History of Medieval Europe. New York 2021.
Hamann, Sven: Wir wollen Mittelalter! Didaktisches Potential für den Schulgeschichtsunterricht. In: Sebastian Barsch (Hg.): Geschichtsdidaktische Perspektive auf die ‚Vormoderne‘. Kiel 2021, 17–22.
Leja, Meg: Embodying the Soul. Medicine and Religion in Carolingian Europe. Philadelphia 2022.
Niedenthal, Tobias / Bernhard Uehleke / Elke Puchtler: Mönchspfeffer: Kritische Notizen zur Arzneipflanze des Jahres 2022. Zeitschrift für Phytotherapie 43 (2022), 255–261.
Palmer, James T.: Merovingian Medicine between Practical Art and Philosophy. Traditio 78 (2023), 17–45.
Röckelein, Hedwig: Medizin und Astronomie in der Karolingerzeit. Bibliotheken als Speicher antiken Wissens. Tübingen 2023.
Palmer, James T.: Merovingian Worlds. Cambridge 2024.
Burridge, Claire: Carolingian Medical Knowledge and Practice, c. 775–900. New Approaches to Recipe Literature. Leiden 2024.
Batten, Caroline: Health and the Body in Early Medieval England. Cambridge 2024.
Palmer, James T.: Bede’s medical books. In: Early Medieval England and its Neighbours 51 (2025), e13.
Letzte Änderungen
- Der Ingwer stärkt das Gedächtnis: Zu Ingwer in der arabischen Medizin
- Yngwer vermischet in die kost ist fast gůt: Ingwer im "Gart der Gesundheit" (1485)
- Ingwer und zweimal so viel Galgant und halb so viel Zitwer: Ingwergewächse bei Hildegard von Bingen
- Presseschau zum Ingwer (Arzneipflanze des Jahres 2026)
- Ingwer ist Arzneipflanze des Jahres 2026
- Walahfrid Strabo: Leben und Werk
- Arzneipflanze des Jahres 2026: Ingwer - Zingiber officinale
- Flüsse und Blüten: Menstruation, weibliche Physiologie und sexuelle Begierde bei Trota von Salerno und Hildegard von Bingen
- Sara von Würzburg und Ortolfs Arzneibuch
- Synthese frühmittelalterlicher Medizin- und Wissenskulturen: Forschungsstand zur Revision des „finsteren Mittelalters“
- Das Zerrbild der Klostermedizin: Von der konfessionellen Polemik zur modernen Forschung
- Warum war das Bild zur Epoche der Klostermedizin so lange schief und ist es zum Teil bis heute?
- Was erzählt die Vita über Hildegard als Heilerin?
- Hildegard von Bingen, Mondfinsternis und das Eruptionscluster 1108–1110
- Presseschau zur Schafgarbe (Arzneipflanze des Jahres 2025)
- Arzneikürbis - Cucurbita pepo L., Cucurbitaceae
- Publikationen zu Autoren & Werken
- Publikationen zur Klostermedizin
- Publikationen zu Pflanzen
- Aktuelles und Termine
- Knoblauch - Allium sativum L., Alliaceae
- Andorn - Marrubium vulgare L., Lamiaceae
- Angelika - Angelica archangelica L., Apiaceae
- Apfelbeere - Aronia MEDIK., Rosaceae
- Sesam - Sesamum indicum L., Pedaliaceae
- Rosen - Rosa-Arten: Rosa gallica L., Rosa centifolia L., Rosa canina L.
- Weißdorn - Crataegus monogyna JACQ.; Crataegus laevigata (POIR.) DC.; Crataegus nigra WALDST. & KIT.
- Mariendistel - Silybum marianum (L.) GAERTNER, Asteraceae
- Lorbeer - Laurus nobilis L., Lauraceae
- Rizinus - Ricinus communis L., Euphorbiaceae
- Arnika - Arnica montana L., Asteraceae
- Ginkgo - Ginkgo biloba L., Ginkgoaceae
- Eukalyptusbaum - Eucalyptus globulus LABILL., Myrtaceae
- Schöllkraut - Chelidonium majus L., Papaveraceae
- Myrte – Myrtus communis, Myrtaceae
- Gewürzsumach - Rhus aromatica AIT., Anacardiaceae
- Borretsch - Borago officinalis L., Boraginaceae
- Keuschlamm oder Mönchspfeffer - Vitex agnus-castus L., Lamiaceae
- Schafgarbe - Achillea millefolium L., Asteraceae
- Beinwell - Symphytum officinale L., Boraginaceae
- Huflattich - Tussilago farfara L., Asteraceae
- Sägepalme - Serenoa repens (BARTR.) SMALL, Arecaceae
- Johanniskraut - Hypericum perforatum L., Hypericaceae
- Presseschau zur Blutwurz (Arzneipflanze des Jahres 2024)
- Pfefferminze - Mentha x piperita L., Lamiaceae
- Alant - Inula helenium L., Asteraceae
- Acker-Schachtelhalm oder Zinnkraut - Equisetum arvense L.
- Aus dem Alltag eines Medizinhistorikers
- Hat Hildegard von Bingen kolloidales Silber empfohlen?
- Woher bekommt man verlässliche Informationen zur Pflanzenheilkunde?
- Literatur
- Arzneipflanze des Jahres 2025: Gemeine Schafgarbe - Achillea millefolium
- Arzneipflanze des Jahres 2024: Blutwurz - Potentilla erecta
- Die Mitglieder
- “Drink before breakfast and vomit”: Zur Geschichte von Hamamelis in Amerika und Europa
- Arzneipflanze des Jahres 2023: Echter Salbei - Salvia officinalis
- Presseschau zum Echten Salbei (Arzneipflanze des Jahres 2023)
- Neues Supermittel: Weg mit Kokos, her mit Ginseng!
- Supermondfinsternis
- Presseschau zum Mönchspfeffer (Arzneipflanze des Jahres 2022)
- Arzneipflanze des Jahres 2022: Mönchspfeffer, Keuschlamm - Vitex agnus-castus
- Fasten (21): Fasten bei Hildegard von Bingen
- Goethe und das Coffein
- Presseschau zum Myrrhenbaum (Arzneipflanze des Jahres 2021)
- Impressum
- Arzneipflanze des Jahres 2021: Myrrhenbaum - Commiphora myrrha
- Deutsches Arzneibuch 6 und Ergänzungsbuch 6
- Kann man sich gegen Infektionen schützen?
- Kontakt
- Fortbildung
- Neuer Ausbildungskurs Klostermedizin und Phytotherapie
- Presseschau zum Lavendel (Arzneipflanze des Jahres 2020)
- Arzneipflanze des Jahres 2020: Echter Lavendel - Lavandula angustifolia
- Weihnachtsgewürze
- Fasten (31): Die Wurzeln des modernen Heilfastens
- Zum 838. Todestag von Hildegard von Bingen
- Presseschau zum Weißdorn (Arzneipflanze des Jahres 2019)
- Immenblatt - Weiße Taubnessel - Zitronenmelisse: Eine Verwechslungsgeschichte über Jahrtausende
- Wir hatten uns doch noch so viel vorgenommen...
- Senföle bekämpfen bakterielle Erreger auf mehreren Ebenen
- Förderung der pankreatischen Restfunktion bei EPI-Patienten durch Rizoenzyme aus Reispilzen
- Feinstaub ohne Feinsinn?
- Zur Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt
- Von tatsächlichen und angeblichen Krebsmitteln aus der Natur
- Erkältungskrankheiten umfassend therapieren: Über den Einsatz von Senfölen und Bitterstoffen
- Buchtipp: Pflanzliche Arzneimittel - was wirklich hilft
- A View to a Kill? Im Angesicht des Todes?
- Mikronährstoffe zwischen Nutzen und Risiko
- Ätherische Öle bei Lyme-Borreliose: Laborstudie deutet auf gute Wirksamkeit verschiedener pflanzlicher Öle hin
- Vorträge in Kooperation mit dem Bund Naturschutz
- Arzneipflanze des Jahres 2019: Weißdorn - Crataegus
- Zum Begriff Naturheilkunde, gängigen Strömungen und zur Abgrenzung des Begriffes
- Die Forschergruppe im ZDF ("Terra X: Drogen – Eine Weltgeschichte")
- Neue internationale Meta-Analyse bestätigt: Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich wirken natürlich gegen Krankheitserreger
- Überlebenschancen nach "alternativer" Krebsbehandlung
- Naturheilkunde in der Krebstherapie
- Themenheft Klostermedizin der "Deutschen Heilpraktiker-Zeitschrift"
- Novartis stoppt Antibiotika-Entwicklung: Pflanzliche Alternativen jetzt noch wichtiger
- Antibakterielle Wirkung von ätherischen Ölen verschiedener Lippenblütler
- Fasten: Ein wiederentdeckter Weg zu Wohlbefinden und seelischem Gleichgewicht