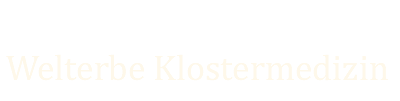Test Showlist
Achillea millefolium - Gemeine Schafgarbe 4.jpg
Adonis vernalis - Adonisroeschen 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Adonis vernalis - Adonisroeschen 1.jpg
Agrostemma githago - Kornrade 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Agrostemma githago - Kornrade 1.jpg
Agrostemma githago - Kornrade 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Agrostemma githago - Kornrade 2.jpg
Alcea rosea - Stockrose 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Alcea rosea - Stockrose 1.jpg
Aloe vera - Curacao-Aloe 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Aloe vera - Curacao-Aloe 1.jpg
Anthemis altissima 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Anthemis altissima 1.jpg
Anthemis tinctoria - Foerber-Kamille 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Anthemis tinctoria - Foerber-Kamille 2.jpg
Aquilegia vulgaris - Akelei 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Aquilegia vulgaris - Akelei 2.jpg
Aquilegia vulgaris - Akelei 3.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Aquilegia vulgaris - Akelei 3.jpg
Arachis hypogaea - Erdnuss 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Arachis hypogaea - Erdnuss 2.jpg
Atropa bella-donna - Tollkirsche 7.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Atropa bella-donna - Tollkirsche 7.jpg
Brassica oleracea ssp. capitata var. capitata f. rubra - Rotkohl 1.jpg
Calendula officinalis - Garten-Ringelblume 4.jpg
Centaurea cyanus - Kornblume 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Centaurea cyanus - Kornblume 1.jpg
Centaurea cyanus - Kornblume 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Centaurea cyanus - Kornblume 2.jpg
Centaurium erythraea - Echtes Tausendgueldenkraut 3.jpg
Cerinthe minor - Kleine Wachsblume 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Cerinthe minor - Kleine Wachsblume 1.jpg
Chamomilla recutita - Echte Kamille 3.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Chamomilla recutita - Echte Kamille 3.jpg
Cichorium intybus ssp. sativus var. foliosum - Chicoree 1.jpg
Cistus ladanifer - Lack-Zistrose 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Cistus ladanifer - Lack-Zistrose 1.jpg
Citrus limon - Zitrone 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Citrus limon - Zitrone 1.jpg
Citrus limon - Zitrone 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Citrus limon - Zitrone 2.jpg
Coffea arabica - Kaffeestrauch 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Coffea arabica - Kaffeestrauch 1.jpg
Conium maculatum - Gefleckter Schierling 5.jpg
Convallaria majalis - Maigloeckchen 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Convallaria majalis - Maigloeckchen 1.jpg
Convallaria majalis - Maigloeckchen 3.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Convallaria majalis - Maigloeckchen 3.jpg
Coriandrum sativum - Koriander 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Coriandrum sativum - Koriander 2.jpg
Corydalis bulbosa - Hohler Lerchensporn 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Corydalis bulbosa - Hohler Lerchensporn 1.jpg
Crataegus laevigata - Zweigriffeliger Weissdorn 1.jpg
Cydonia oblonga var. maliformis - Quitte Apfelform 2.jpg
Datura metel - Arabischer Stechapfel 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Datura metel - Arabischer Stechapfel 2.jpg
Dianthus carthusianorum - Karthaeuser-Nelke 1.jpg
Dicentra spectabilis - Traenendes Herz 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Dicentra spectabilis - Traenendes Herz 1.jpg
Echinaceae purpurea - Rote Kegelblume 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Echinaceae purpurea - Rote Kegelblume 1.jpg
Equisetum palustre - Sumpf-Schachtelhalm 1.jpg
Euonymus europaeus - Pfaffenhuetchen 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Euonymus europaeus - Pfaffenhuetchen 1.jpg
Euphorbia serrata - Gesaegte Wolfsmilch 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Euphorbia serrata - Gesaegte Wolfsmilch 1.jpg
Fragaria vesca - Wald-Erdbeere 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Fragaria vesca - Wald-Erdbeere 2.jpg
Frangula alnus - Faulbaum 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Frangula alnus - Faulbaum 1.jpg
Frangula alnus - Faulbaum 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Frangula alnus - Faulbaum 2.jpg
Galium odoratum - Waldmeister 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Galium odoratum - Waldmeister 1.jpg
Galium odoratum - Waldmeister 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Galium odoratum - Waldmeister 2.jpg
Galium verum - Echtes Labkraut 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Galium verum - Echtes Labkraut 2.jpg
Gaultheria procumbens - Wintergruen 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Gaultheria procumbens - Wintergruen 1.jpg
Geranium sanguineum - Blut-Storchschnabel 1.jpg
Ginkgo biloba - Ginkgo 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Ginkgo biloba - Ginkgo 1.jpg
Grindelia robusta - Grindelkraut 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Grindelia robusta - Grindelkraut 1.jpg
Grindelia robusta - Grindelkraut 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Grindelia robusta - Grindelkraut 2.jpg
Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 1.jpg
Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 2.jpg
Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 3.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Helichrysum arenarium - Sand-Strohblume 3.jpg
Helleborus viridis - Gruene Nieswurz 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Helleborus viridis - Gruene Nieswurz 1.jpg
Heracleum sphondylium - Wiesenbaerenklau 1.jpg
Hieracium aurantiacum - Orangerotes Habichtskraut 1.jpg
Hieracium lanatum - Wolliges Habichtskraut 1.jpg
Hippophae rhamnoides - Sanddorn 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Hippophae rhamnoides - Sanddorn 1.jpg
Humulus lupulus - Hopfen 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Humulus lupulus - Hopfen 1.jpg
Juglans regia - Echte Walnuss 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Juglans regia - Echte Walnuss 2.jpg
Laurus nobilis - Lorbeer 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Laurus nobilis - Lorbeer 1.jpg
Leucanthemum vulgare - Margerite 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Leucanthemum vulgare - Margerite 1.jpg
Lysimachia nummularia - Pfennigkraut 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Lysimachia nummularia - Pfennigkraut 1.jpg
Melissa officinalis - Melisse 4.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Melissa officinalis - Melisse 4.jpg
Mentha aquatica - Bachminze 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Mentha aquatica - Bachminze 1.jpg
Mentha piperita - Echte Pfefferminze 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Mentha piperita - Echte Pfefferminze 1.jpg
Mentha piperita - Echte Pfefferminze 8.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Mentha piperita - Echte Pfefferminze 8.jpg
Nymphaea - Seerose 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Nymphaea - Seerose 2.jpg
Paeonia officinalis - Pfingstrose 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Paeonia officinalis - Pfingstrose 2.jpg
Prunus dulcis - Mandelbaum 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Prunus dulcis - Mandelbaum 1.jpg
Pulmonaria officinalis - Lungenkraut 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Pulmonaria officinalis - Lungenkraut 1.jpg
Pulsatilla vulgaris - Kuhschelle 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Pulsatilla vulgaris - Kuhschelle 1.jpg
Punica granatum - Granatapfel 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Punica granatum - Granatapfel 1.jpg
Ranunculus acris - Scharfer Hahnenfuss 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Ranunculus acris - Scharfer Hahnenfuss 1.jpg
Rauvolfia serpentina - Indische Schlangenwurzel 1.jpg
Rauvolfia serpentina - Indische Schlangenwurzel 2.jpg
Rubus fruticosus - Echte Brombeere 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Rubus fruticosus - Echte Brombeere 1.jpg
Ruta graveolens - Weinraute 3.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Ruta graveolens - Weinraute 3.jpg
Salvia officinalis - Echter Salbei 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Salvia officinalis - Echter Salbei 1.jpg
Sempervivum tectorum - Dachwurz 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Sempervivum tectorum - Dachwurz 1.jpg
Silene coronaria - Kronen-Lichtnelke 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Silene coronaria - Kronen-Lichtnelke 1.jpg
Silybum marianum - Mariendistel 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Silybum marianum - Mariendistel 2.jpg
Silybum marianum - Mariendistel 4.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Silybum marianum - Mariendistel 4.jpg
Silybum marianum - Mariendistel 5.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Silybum marianum - Mariendistel 5.jpg
Solanum melongena - Aubergine 2.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Solanum melongena - Aubergine 2.jpg
Tagetes patula - Studentenblume 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Tagetes patula - Studentenblume 1.jpg
Tanacetum cinerariifolium - Dalmatinische Insektenblume 1.jpg
Theobroma cacao - Kakao 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Theobroma cacao - Kakao 1.jpg
Tropaeolum majus - Grosse Kapuzinerkresse 1.jpg
Tropaeolum majus - Grosse Kapuzinerkresse 2.jpg
Rosa centifolia - Zentfolie Kohlrose 1.jpg
http://s301092325.online.de/we15/images/pflanzenbilder/Rosa centifolia - Zentfolie Kohlrose 1.jpg
Flüsse und Blüten: Menstruation, weibliche Physiologie und sexuelle Begierde bei Trota von Salerno und Hildegard von Bingen
Zusammenfassung
Im lateinischen Westen des 12. Jahrhunderts entwerfen Trota von Salerno und Hildegard von Bingen zwei grundlegend verschiedene Bilder weiblicher Physiologie und Sexualität. Als zwei der wenigen namentlich bekannten Autorinnen medizinischer Traktate repräsentieren sie seltene weibliche Stimmen in der Gelehrsamkeit ihrer Zeit. Während die salernitanische Heilkundige Trota – greifbar vor allem in De curis mulierum und der Practica secundum Trotam – einen pragmatisch-klinischen Zugriff pflegt, bündeln sich Hildegards medizinisch-anthropologische Vorstellungen in den Causae et curae. Obschon beide Menstruation, Empfängnis und geschlechtliches Begehren in das tradierte Modell der Humoralpathologie einbetten, divergieren sie fundamental in Bewertung, narrativer Einbindung und therapeutischer Einordnung.
Trotas Umfeld, wie es Monica H. Greens Forschungen zum Trotula-Ensemble rekonstruieren, begreift die Menstruation als Teil eines Kontinuums normaler weiblicher „Flüsse”, die klinisch zu überwachen und therapeutisch zu modulieren sind. Ein anderes Bild zeichnet Hildegard: In den Causae et curae (ediert von Moulinier, analysiert von Riha) rücken Menstruationsblut und sexuelle Begierde in einen heilsgeschichtlichen Horizont. Sie erscheinen als unmittelbare Folgen des Sündenfalls und als Orte moralischer Ambivalenz, an denen göttliche Ordnung und menschliche Hinfälligkeit aufeinandertreffen.
Dem salernitanischen, auf die Steuerung von Flüssigkeitshaushalten zielenden Zugriff steht eine monastisch geprägte Medizin gegenüber, in der Körperbilder stets auch theologische Aussagen transportieren. Im Kontrast zwischen klinischer Orientierung und visionärer Deutung wird die Vielfalt medizinischer Autorität um 1200 sichtbar – eine Epoche, in der Frauen sowohl als namentlich fassbare Heilkundige als auch als Prophetinnen wirkmächtige Konzepte von Gesundheit und Krankheit formulierten.
1. Einleitung
In der modernen Historiographie werden Trota von Salerno und Hildegard von Bingen üblicherweise in getrennten Fachbereichen behandelt. Trota erscheint zumeist in Überblicksdarstellungen zur mittelalterlichen Gynäkologie als schattenhafte Vertreterin der „Frauen von Salerno” und als mutmaßliche Autorin jenes Kompendiums zur Frauenheilkunde, das später unter dem Namen Trotula kanonisiert wurde. Hildegard hingegen gilt als Ausnahmeerscheinung mittelalterlicher Spiritualität; ihre naturkundlichen und medizinischen Schriften wurden lange vom visionären Makrokosmos von Scivias überlagert. Erst die jüngere Forschung konnte beide Figuren präziser verorten: für Trota die philologisch-kodikologischen Arbeiten Monica H. Greens (Green 1996; 1999; 2023), für Hildegard die Edition der Causae et curae (C+C) durch Laurence Moulinier (2003), die medizinhistorischen Studien Reiner Hildebrandts, die Analysen Ortrun Rihas (2011a; 2011b) sowie die Untersuchung Minji Lees zum weiblichen Reproduktionskörper (2025).
Vielmehr als eine direkte Einflusslinie von Salerno in das Rheinland zu behaupten, ist nach den Möglichkeiten einer gemeinsamen Lektüre zu fragen. Zwar wirkten salernitanische Texte im 12. und 13. Jahrhundert weit über den süditalienischen Raum hinaus, doch erlaubt die Quellenlage keinen Rückschluss darauf, dass Trotas Schriften den Rupertsberg erreichten. Ziel der folgenden Erörterung ist es, die nahezu zeitgleichen Behandlungen von Menstruation, Empfängnis und sexueller Begierde als Kristallisationspunkte zweier grundverschiedener Denkweisen über den weiblichen Körper freizulegen.
Ein Vergleich beider Autorinnen setzt bei deren divergierenden institutionellen Kontexten an. Trota agiert im Umfeld der Civitas Hippocratica, jener aufstrebenden medizinischen Schule Salernos, in der sich ab dem 11. Jahrhundert eine Professionalisierung der Heilkunde vollzog. Kennzeichnend ist eine zunehmende Säkularisierung medizinischen Wissens und die Verschmelzung lokaler empirischer Praxis mit den neu rezipierten galenisch-arabischen Theorien. Trotas Autorität speist sich aus klinischer Erfahrung und der Teilhabe an einem gelehrten Diskurs, der – obschon er Frauen zunehmend an den Rand drängte – im 12. Jahrhundert noch Räume für weibliche Expertise in Gynäkologie und Kosmetik bot.
Hildegards Werk hingegen ist untrennbar mit der monastischen Kultur des Rheinlands und ihrem Status als Visionärin verknüpft. Ihre medizinischen Ausführungen verstehen sich als Teil einer durch göttliche Inspiration beglaubigten Gesamtschau von Kosmos, Mensch und Heil. Die Autorität, mit der sie über den weiblichen Körper spricht, ist prophetischer Natur und muss sich gegenüber kirchlichen und monastischen Hierarchien behaupten. Während in Salerno Empirie und Tradierung antiker Lehrsätze das Fundament bilden, ist es am Rupertsberg die prophetische Exegese, die physiologische Vorgänge in eine universale Ordnung einbettet.
In der konkreten Beschreibung des weiblichen Körpers treten diese Unterschiede deutlich hervor. Auf salernitanischer Seite wird der Frauenkörper primär als ein durch Feuchtigkeit und Kälte charakterisiertes System verstanden. Die Menstruation fungiert als notwendige Reinigung und Regulation dieses Flüssigkeitshaushaltes. In Trotas Texten begegnet ein pragmatisches Vokabular: Es geht um die Induktion oder Dämpfung von Flüssen (fluxus), um Uterusverhaltung oder Beschwerden nach der Geburt. Der Fokus liegt auf der Wiederherstellung funktionaler Integrität, wobei theologische Deutungen nahezu vollständig hinter das klinische Management zurücktreten.
Hildegard integriert diese humoralpathologischen Grundlagen in eine weit ausgreifende heilsgeschichtliche Erzählung. Für sie ist die Menstruation kein bloßer Reinigungsprozess, sondern ein bleibendes Zeichen postlapsarischer Bedingtheit. Blutfluss und sexuelle Lust erfahren in C+C eine konsequente moralische Aufladung. Die Libido wird als Symptom der durch den Sündenfall „verwundeten” Natur gedeutet, die jedoch im Rahmen der göttlichen Schöpfungsordnung ihren Platz behält. Physiologische Prozesse wie das „Blühen” der Frau oder der Verfall im Alter werden zu Chiffren für den Zustand der Seele und die Stellung des Menschen im Kosmos.
Damit stehen sich zwei Weisen des Denkens gegenüber, die den weiblichen Körper auf unterschiedlichen Ebenen konstituieren: hier die klinische Steuerung eines biologischen Systems, dort die exegetische Durchdringung eines moralisch-kosmischen Zeichens. Die Nebeneinanderstellung erlaubt es, die Geschichte der Frauenheilkunde nicht länger als linearen Fortschritt, sondern als Feld konkurrierender Wissensformen und Autoritätsansprüche zu begreifen.
2. Trota von Salerno und das Trotula‑Ensemble
Trota von Salerno ist innerhalb der Überlieferung in ein komplexes Geflecht aus legendarischen Zuschreibungen und philologischen Befunden eingebettet. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein verdeckte die Sammelbezeichnung „Trotula” – die sowohl als Name einer vermeintlichen Autorin als auch als Titel eines verbreiteten Kompendiums fungierte – die tatsächlichen Urheberinnenverhältnisse. Erst Monica H. Green belegte, dass der unter dem Titel De passionibus mulierum ante, in et post partum kanonisierte Druck auf der Zusammenfügung dreier ursprünglich autonomer salernitanischer Traktate des 12. Jahrhunderts beruht: dem Liber de sinthomatibus mulierum (LSM), De curis mulierum (DCM) und De ornatu mulierum (DOM) (Green 1996). Zugleich systematisierte Green die fragmentarische Evidenz für eine historische Trota, deren Name in Varianten (Trocta, Trota, Trotula) begegnet, obschon sie dort nicht explizit als medica tituliert wird.
Den Kern des Trota-Corpus bilden in Greens Rekonstruktion DCM und die Practica secundum Trotam. DCM präsentiert sich als eine nach Krankheitsbildern gegliederte Folge prägnanter, rezeptartiger Kapitel. Das Spektrum reicht von Diagnostik bei Infertilität und Zyklusstörungen über die Begleitung von Gravidität und Geburt bis zur postpartalen Versorgung sowie der Behandlung von Uterusprolaps und pathologischen Flüssen. Die Einträge folgen zumeist einem festen Duktus: Auf bündige Charakterisierung des Leidens und Hinweis auf dessen humoralpathologische Genese folgt die Angabe spezifischer Therapeutika in Form von Bädern, Räucherungen, Pessaren, Salben oder Tränken. Das Spezifische von DCM liegt weniger in theoretischer Neuausrichtung als in der Dichte des praktischen Wissensschatzes und der expliziten Nennung einer weiblichen Autorität.
Eine wesentliche Erweiterung erfährt dieses Profil durch die Practica secundum Trotam (Cantalupo 1995). Überliefert im Madrider Constantinus-Codex sowie im verlorenen Breslauer Sammelmanuskript De egritudinum curatione, stellt dieser Text keinen systematischen Traktat dar, sondern ein aus praktischen Notizen und Exzerpten gefügtes Opusculum. Trotas Name ist hier sowohl im Titel als auch in einzelnen Zuschreibungen verankert. Die thematische Breite überschreitet die Grenzen der Gynäkologie deutlich; sie umfasst Fieberzustände ebenso wie Verdauungsstörungen oder dermatologische Befunde und adressiert männliche wie weibliche Patienten gleichermaßen. Für den vorliegenden Vergleich bilden DCM und die Practica das primäre Quellenfundament für Trotas medizinisches Denken, während LSM und DOM als Erzeugnisse des weiteren salernitanischen Milieus gelten.
3. Hildegards Causae et curae
Hildegard von Bingen ist vor allem als visionäre Äbtissin und Theologin bekannt. Ihr medizinisch-naturkundliches Werk, namentlich die Physica und die Causae et curae (C+C), galt in der älteren Rezeption lange als der großen Visionstrilogie nachgeordnet oder wurde als bloße Kompilation tradierter Lehren missverstanden. Die jüngere Forschung, maßgeblich vorangetrieben durch Laurence Moulinier, Reiner Hildebrandt und Ortrun Riha, revidierte dieses Bild, indem sie innere Kohärenz, spezifische Bildlichkeit und argumentative Strategien dieser Texte als eigenständige medizinische Anthropologie erschloss (Riha 2011a; 2011b).
C+C entstand um die Mitte des 12. Jahrhunderts, vermutlich in engem zeitlichem Zusammenhang mit der Physica. Die Überlieferung ruht im Wesentlichen auf einer nahezu vollständigen Kopenhagener Abschrift des 13. Jahrhunderts sowie dem Berliner Fragment. Auf diesem schmalen Fundament fußen die Edition von Paul Kaiser (1903) sowie Mouliniers kritische Neuausgabe (2003). Wie Riha betont, liegt das besondere Verdienst der Moulinier’schen Edition im Verzicht auf die verwirrende Kapiteleinteilung der Erstedition sowie in einem ausführlichen Stellenkommentar.
Die ersten beiden Bücher beschreiben die Weltordnung sowie Ursprung und Therapie von Krankheiten, die folgenden Teile enthalten Rezepte und Prognosen. Die für Menstruation, sexuelle Begierde und Reproduktion entscheidenden Passagen konzentrieren sich im zweiten Buch. Darin entfaltet Hildegard die Genese des Menschen, die Anatomie des Körpers sowie die Verknüpfung von Säftehaushalt und Temperament. Zentrale Kategorien, etwa die vitale Kraft der viriditas, finden hier Eingang in eine medizinische Fachsprache, die zwar an humoralpathologische Modelle anknüpft, diese jedoch visionär überformt.
C+C bleibt untrennbar mit der visionären Trilogie aus Scivias, Liber vitae meritorum (LVM) und Liber divinorum operum (LDO) verschränkt. Bereits in Scivias wird der Sündenfall in Bildern artikuliert, welche die geschlechtliche Differenzierung, das Aufkommen der concupiscentia und die Spannung zwischen viriditas und Verwelkung als somatische Realität markieren. In diesem Gefüge ist die Menstruation niemals ein bloß physiologisches Ereignis, sondern ein Zeichen, in dem Kosmologie, Anthropologie und Moraltheologie unmittelbar zusammenlaufen.
Rihas Studien arbeiten die prägende Kraft der hildegardischen Bildlichkeit heraus. Metaphern von reißenden Flüssen, gärendem Most oder wechselnden Jahreszeiten fungieren in C+C nicht als schmückendes Beiwerk, sondern als kognitive Werkzeuge. Sie leiten dazu an, das partikulare Phänomen – etwa den Blutfluss der Frau oder das Aufwallen männlicher Lust – mit dem universalen Muster göttlicher Vorsehung zu verknüpfen. Gerade diese Verschränkung klinischer Details mit einer heilsgeschichtlichen Gesamterzählung markiert die Distanz zu Trotas pragmatisch-interventionistischem Zugriff.
4. Flüsse und Sündenfall: Trota und Hildegard im Vergleich
Im Folgenden werden drei zentrale Themenfelder nebeneinandergelegt: Menstruation, sexuelle Begierde und Empfängnis. Die Beobachtungen stützen sich auf salernitanischer Seite vor allem auf DCM, die Practica secundum Trotam und LSM, auf hildegardischer Seite auf die entsprechenden Abschnitte von C+C.
4.1 Menstruation
In DCM und in der Practica wird die Menstruation primär als Vorgang aufgefasst, der sich beobachten und im Hinblick auf Gesundheit und Fruchtbarkeit regulieren lässt. Gleich zu Beginn von DCM werden Frauen beschrieben, bei denen die Monatsblutungen ausbleiben oder nur schwach einsetzen: „Sunt quedam mulieres que cum ueniuni ad tempus menstruorum, nulla uel modica habent menstrua. Quibus sic subuenimus” (DCM 132). Die Rezepte arbeiten mit Räucherungen, Pessaren, Bädern und Aderlässen, um „ad menstrua provocanda” beziehungsweise „ad nimios fluxus cohibendos” beizutragen. Entscheidend ist, dass sich ein regelmäßiger, nicht schädlicher Fluss einstellt und die Frau wieder zur Empfängnis befähigt wird.
Ein weiteres Rezept illustriert diesen Übergang von Menstruationsstörung zu Empfängnisfähigkeit. Für Frauen, die aufgrund von „Frigidität” nicht empfangen, wird angeordnet: „Si uero ex frigiditate laborat, quod melius est, apulegio et foliis lauri et persiccaria mulieri faciamus fumigium et pessarium, et sic habundancia humorum mundificata, habilis erit ad concipiendum” (DCM 134). Die „Überfülle der Säfte” soll durch Fumigationen und Pessare gereinigt werden. Ist sie „mundificata”, gilt die Frau als „habilis ad concipiendum”. Menstruation erscheint somit als regulierbarer Fluss im Dienst der Fortpflanzung.
Die theoretische Grundlage liefert LSM mit einem in der Forschung häufig zitierten Vergleich. Dort hält der Autor fest, die Natur habe den Frauen eine besondere Reinigungsform zugedacht: „scilicet menstrua, que uulgus appellat flores, quia sicut arbores non afferunt sine floribus fructus, sic mulieres sine suis floribus sue conceptionis officio defraudantur. Huiusmodi autem purgatio contingit mulieribus, sicut uiris de nocte accidit pollutio” (LSM 3). Menstruation gilt damit als natürliches, regelmäßig wiederkehrendes Zeichen der Fruchtbarkeit, das strukturell der männlichen Pollution entspricht.
Hildegard deutet die Menstruation hingegen als besonders deutliches Zeichen für den gefallenen Zustand des Menschen. In den anthropologischen Partien des Liber II betont sie, dass es im paradiesischen Leib keine so heftigen Blutbewegungen gegeben habe. Erst als concupiscentia in Eva eindringt, entstehe eine neue, stürmische Bewegung des Blutes, die nun periodisch abgeleitet werden müsse. Zugleich hält sie fest, dass ohne diese monatliche Purgation der weichere, feuchtere Frauenkörper von seinem eigenen Übermaß überwältigt würde. Eine zentrale Passage fasst diesen Doppelcharakter zusammen: „Riuulus autem menstrui temporis in muliere est genitiua uiriditas et floriditas eius, quae in prole frondet, quia ut arbor uiriditate sua floret et frondet et fructus profert, sic femina de uiriditate riuulorum menstrui sanguinis flores et frondes in fructu uentris sui educit” (II 227). Wie Lee hervorhebt, gehört zu dieser Deutung auch, dass die poröse, von Flüssen geprägte Leiblichkeit der Frau nicht nur als Defizit, sondern als Medium göttlicher Lebenskraft angesehen wird (Lee 2025).
Die Rezeptteile der späteren Bücher zeigen, dass Hildegard Menstruationsstörungen ebenso konkret therapeutisch fasst: „Mulier ergo, que obstrusa menstrua patitur et inde dolet, accipiat anesum et febrefugiam equali pondere et wullenam aliquantum plus, quam unius istorum sit, et eas coquat aperto et fluento flumine…” (IV 394). Das Ziel ist: „ut per humores herbarum istarum cutis et caro illius exterius et matrix interius mollificetur et ut uene eius, que clause sunt, aperiantur” (IV 394). Die verhärtete Matrix soll „erweicht” und die verschlossenen Gefäße geöffnet werden.
Im direkten Vergleich fällt auf, dass Trota und der anonyme Autor von LSM die Menstruation eng an Pollution und Empfängnis binden und vor allem ihre reinigende und fruchtbarkeitsfördernde Funktion hervorheben. Das florale Bild („menstrua, que vulgus appellat flores … sicut arbores … sic mulieres”) macht diesen Zusammenhang anschaulich. Hildegard greift dieselbe Bildwelt von Baum, Blüte und Frucht auf, verbindet sie aber mit ihrer Lehre von viriditas und Sündenfall. Der riuulus menstrui temporis bleibt bei ihr Teil eines Naturhaushalts und wird zugleich in eine heilsgeschichtliche Deutung einbezogen.
4.2 Sexuelle Begierde
Trotas Texte und LSM greifen sexuelle Begierde vor allem dort auf, wo diese mit körperlichen Beschwerden verbunden ist. LSM beschreibt in einem häufig zitierten Kapitel die Lage von Frauen, die keinen Geschlechtsverkehr haben sollen: „Contingit autem hoc eis que uiris non utuntur, maxime uiduis que consueuerunt uti carnali commercio. Virginibus etiam solet euenire cum ad annos nubiles peruenerunt et uiris uti non possunt, et cum in eis multum habundet sperma, quod per masculum natura uellet educere…” (LSM 47). Das Problem ist nicht die Lust als solche, sondern die Stauung von Samen und Hitze. Entsprechend verordnet Trota innere und äußere Mittel, welche die aufgestaute Erregung kühlen oder zerstreuen.
Bei Hildegard ist sexuelle Begierde in C+C nie nur ein körperlicher Vorgang. Sie beschreibt sie so, dass immer auch eine moralische Bewertung mitschwingt. Im Liber II kennzeichnet sie die männliche Lust als „tempestas libidinis”: „Nam cum tempestas libidinis in masculo surgit, in eo ut molendinum circumuoluitur, quia etiam lumbi eius velut fabrica sunt, in quam medulla ignem mittit, ita quod et fabrica illa eundem ignem in genitalia loca masculi transfundit ac eum fortiter ardere facit” (II 151). Die Bilder von Mühlrad, Werkstatt und Feuer halten zugleich die Bewegung des Körpers und die Gefährdung des inneren Maßes fest.
Auch im therapeutischen Teil greift Hildegard die Frage nach übermäßiger Begierde auf. Im vierten Buch beschreibt sie, wie einem Menschen geholfen werden soll, „qui de superfluitate libidinis in oculis caligat, siue masculus siue femina sit” (IV 404). Die Maßnahme soll die „superfluitas libidinis” bremsen, ohne die Augen zu schädigen. Auch hier erscheint Begierde als etwas, das sich medizinisch beeinflussen lässt, nicht nur als moralisches Problem.
Beim Vergleich zeigt sich ein unterschiedlicher Fokus. LSM lokalisiert das Problem in der aufgestauten Sexualenergie, insbesondere bei Witwen und Jungfrauen, deren Lebensform Geschlechtsverkehr ausschließt. Wo „multum habundet sperma”, drohen Schmerzen, Hitze und andere Beschwerden. Die Lösung ist medizinisch-therapeutisch. Hildegard interessiert sich dagegen weniger für konkrete Lebenslagen als für die Dynamik der Begierde selbst. Die „tempestas libidinis” ist für sie ein nach dem Sündenfall gefährlich gewordener Sturm, der nur dann nicht zerstörerisch wirkt, wenn er in eine geordnete Liebe eingebunden ist. Während Trota und LSM Begierde primär als Faktor im Kalkül der Gesundheit behandeln, wird sie bei Hildegard zum Indikator für den Zustand der Seele.
4.3 Empfängnis und Gestaltung der Nachkommenschaft
In den salernitanischen Texten gilt Empfängnis als Resultat richtig disponierter Körper und Momente. DCM und die Practica erörtern Frauen, die nicht empfangen, weil sie zu kalt und feucht, zu heiß und trocken, zu dick oder zu dünn sind oder weil sich die Öffnung der Gebärmutter nicht zur rechten Zeit öffnet. Die bereits zitierte Kur für Frauen, die „ex frigiditate laborant” (DCM 134), zeigt exemplarisch, wie Empfängnisfähigkeit gedacht ist. Die innere „habundancia humorum” muss durch passende Bäder, Fumigationen und Pessare gereinigt und neu balanciert werden. Moralische oder emotionale Zustände des Paares spielen in der Darstellung nur eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist die richtige Mischung von Wärme, Feuchtigkeit und Substanzdichte der Säfte.
Bei Hildegard treten Fragen von Temperament und Lebensführung bei der Empfängnis stärker in den Vordergrund. Dort, wo sie das Verhältnis von rechtmäßiger Ehe und Unzucht erörtert, richtet sie den Blick ausdrücklich auf die entstehenden Kinder: „Vnde filii aut filie, quos sic de se producunt, multotiens diabolicam insaniam in uitiis et in moribus suis habent, quoniam absque caritate emissi sunt. Nam qui de hiis nascuntur, sepe infelices erunt et tortuosi in omnibus moribus suis…” (II 148). Zeugung „absque caritate” hinterlässt Spuren in der seelisch-körperlichen Disposition der Nachkommenschaft.
Neuere Interpretationen von C+C, insbesondere bei Riha und Moulinier, heben hervor, dass Hildegard hier gängige humoralphysiologische Annahmen über Vererbung mit ihrer moralisch-theologischen Anthropologie verknüpft. Die innere Qualität von Begierde, Liebe und Zorn gehört für sie zu den Faktoren, die den Leib des entstehenden Kindes mitformen. Empfängnis ist damit nicht nur ein Vorgang zur richtigen Zeit bei der richtigen Temperatur, sondern auch ein Ort, an dem sich Haltungen und Affekte der Eltern niederschlagen.
Fasst man die drei Themenfelder zusammen, zeigt sich, dass Trota und Hildegard mit ähnlichen humoralphysiologischen Annahmen zu Wärme, Feuchtigkeit, Blutflüssen und Fruchtbarkeit arbeiten. In den salernitanischen Texten werden Menstruation, Lust und Empfängnis in erster Linie als Vorgänge beschrieben, die der Arzt beobachten, deuten und behandeln soll. Theologische Überlegungen treten nur am Rand auf. Hildegards Traktat knüpft zwar an dieselben Kategorien an, liest dieselben Abläufe aber vor dem Hintergrund von Schöpfung, Sündenfall und Erlösung. Was bei Trota vor allem als Frage des richtigen Maßes der Säfte erscheint, wird bei Hildegard zu einem Feld, auf dem sich auch der geistliche Zustand des Menschen manifestiert.
5. Moderne Rezeptionsweisen und Fehllektüren
Die unterschiedlichen Konfigurationen von Menstruation, Sexualität und weiblicher Physiologie bei Trota und Hildegard sind nicht im 12. Jahrhundert verblieben, sondern wurden in der modernen Forschung und populären Kultur wieder aufgegriffen, vereinfacht und bisweilen verzerrt. Ein kurzer Blick auf diese Rezeptionsgeschichten schärft das Bewusstsein dafür, warum eine genaue Lektüre der mittelalterlichen Texte notwendig ist.
Auf Seiten Trotas hat insbesondere Green nachgezeichnet, wie das zusammengesetzte Etikett „Trotula” und das fragile Dossier zu Trota selbst immer wieder in Erzählungen von „ersten Professorinnen” und von einer verlorenen, authentisch weiblichen Medizin eingebunden wurden (Green 1996; 1999; 2008; 2023). Ihre Arbeiten demontieren sowohl die Vorstellung eines einheitlichen Lehrbuchs aus einer Hand als auch die Versuchung, moderne Erwartungen an weibliche Emanzipation oder Marginalisierung ungebrochen auf die salernitanische Evidenz zu projizieren. Green insistiert auf dem kompositen Charakter des Ensembles und auf Trotas ambivalenter Position darin. Einerseits gilt sie als namentlich genannte Autorität, andererseits als Figur, deren Stimme teilweise in späteren Redaktionsprozessen unterging. Populäre Darstellungen, die „Trotula” als protofeministische Heldin der Gynäkologie feiern, neigen dazu, gerade diese textlichen Komplexitäten zu nivellieren.
Hildegards medizinische Schriften haben demgegenüber seit dem späten 20. Jahrhundert eine umfangreiche „Hildegard-Medizin”-Industrie hervorgebracht. Rihas Studien zu C+C und Fischers Überblick zeigen, wie weit diese Rezeptionsformen sich von Aufbau und Argumentationsweise der einschlägigen Texte entfernen können (Riha 2011a; 2011b; Fischer 2005). Lees Monographie hat Hildegards Vorstellungen vom weiblichen Reproduktionskörper und den damit verbundenen „Flüssen” systematisch herausgearbeitet und zeigt, wie sorgfältig die Bildsprache von C+C an biblische und medizintheoretische Kontexte rückgebunden ist (Lee 2025). Die visionäre und heilsgeschichtliche Architektur wird in populären Ratgebern häufig zu einem zeitlosen Set von Therapie-Tipps und Diätregeln eingeebnet. Die dichten Bildnetze, mit denen der Traktat humoralphysiologische Prozesse mit Sünde, Tugend und Eschatologie verschränkt, werden entweder vage moralisiert oder ihres theologischen Gehalts vollständig entkleidet.
Eng damit verwandt ist jene Rezeption, die Hildegard als proto-„Naturärztin” konstruiert, deren Aussagen über den weiblichen Körper für die moderne Alternativmedizin ausgebeutet werden könnten. In diesem Diskurs werden Menstruation und weibliche Sexualität häufig als Ausdruck einer zeitlosen „weiblichen Natur” umcodiert, die harmonisiert, nicht historisch befragt werden müsse. Eine solche Lesart löst Hildegard sowohl vom gelehrten Medizinbetrieb als auch von den theologischen Debatten ihrer Zeit ab. Sie verdeckt, wie stark ihre Darstellungen weiblicher Physiologie von monastischen Normen und lateinischen intellektuellen Traditionen geprägt sind (Mayer/Niedenthal 2018).
Diese modernen Aneignungen ändern den mittelalterlichen Befund nicht, schärfen aber das Bewusstsein dafür, warum sorgfältige philologische und kontextuelle Arbeit nötig ist. Greens Rekonstruktion Trotas und des Trotula-Ensembles und die textnahen Lektüren von C+C durch Riha, Moulinier und andere stellen Instrumente zur Verfügung, um sowohl der Romantisierung einer verlorenen „Frauenmedizin” als auch der Kommerzialisierung visionärer Theologie als Lifestyle-Ratgeber zu widerstehen.
Primärliteratur
Cantalupo, Piero (Hg.): Practica secundum Trotam. In: Salerno e Principato Citra 13 (1995), S. 1–104.
Green, Monica H. (Hg. und Übers.): The Trotula. A Medieval Compendium of Women’s Medicine. Philadelphia 2001.
Hildebrandt, Reiner / Gloning, Thomas (Hg.): Hildegard von Bingen, Physica. Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum. 3 Bde. Berlin 2010–14.
Moulinier, Laurence (Hg.): Hildegardis Bingensis, Causae et curae. Beate Hildegardis Cause et cure (Rarissima mediaevalia 1). Berlin 2003.
Riha, Ortrun (Übers.): Ursprung und Behandlung der Krankheiten – Causae et Curae. Hildegard von Bingen – Werke, Bd. 2. Beuron: Beuroner Kunstverlag 2011.
Sekundärliteratur
Fischer, Klaus-Dietrich: Hildegard von Bingen – Kranke und Heilerin. In: Das Mittelalter 10 (2005), H. 1, S. 20–34.
Green, Monica H.: The Development of the Trotula. In: Revue d’Histoire des Textes 26 (1996), S. 119–203.
Green, Monica H.: In Search of an “Authentic” Women’s Medicine. The Strange Fates of Trota of Salerno and Hildegard of Bingen. In: Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 19 (1999), S. 25–54.
Green, Monica H.: Flowers, Poisons, and Men. Menstruation in Medieval Western Europe. In: Andrew Shail / Gillian Howie (Hg.): Menstruation. A Cultural History. New York 2005, S. 51–64.
Green, Monica H.: Making Women’s Medicine Masculine. The Rise of Male Authority in Premodern Gynaecology. Oxford 2008.
Green, Monica H.: Who/What is “Trotula”? In: Knowledge Commons (2023), DOI 10.17613/y8n1-w358.
Lee, Minji: The Medieval Womb: Hildegard of Bingen’s Views on the Female Reproductive Body. York 2025.
Mayer, Johannes Gottfried / Niedenthal, Tobias: Hildegard – ein Mythos? In: Deutsche Heilpraktiker-Zeitschrift 13 (2018), H. 4, S. 60–63.
Moulinier, Laurence: Hildegarde ou Pseudo-Hildegarde? Réflexions sur l’authenticité du traité Cause et cure. In: Im Angesicht Gottes suche der Mensch sich selbst. Hildegard von Bingen (1098–1179). Mainz 2001 (Erudiri Sapientia II), S. 115–146.
Riha, Ortrun: Weil der Maulwurf sich manchmal zeigt. Argumentationsstrukturen in Hildegards Causae et curae. In: Sudhoffs Archiv 95 (2011), H. 2, S. 222–234.
Riha, Ortrun: Reißende Flüsse, schäumende Töpfe. Die Bedeutung der Bilder in Hildegards von Bingen Causae et curae. In: Concilium Medii Aevi 14 (2011), S. 223–237.
Letzte Änderungen
- Der Ingwer stärkt das Gedächtnis: Zu Ingwer in der arabischen Medizin
- Yngwer vermischet in die kost ist fast gůt: Ingwer im "Gart der Gesundheit" (1485)
- Ingwer und zweimal so viel Galgant und halb so viel Zitwer: Ingwergewächse bei Hildegard von Bingen
- Presseschau zum Ingwer (Arzneipflanze des Jahres 2026)
- Ingwer ist Arzneipflanze des Jahres 2026
- Walahfrid Strabo: Leben und Werk
- Arzneipflanze des Jahres 2026: Ingwer - Zingiber officinale
- Flüsse und Blüten: Menstruation, weibliche Physiologie und sexuelle Begierde bei Trota von Salerno und Hildegard von Bingen
- Sara von Würzburg und Ortolfs Arzneibuch
- Synthese frühmittelalterlicher Medizin- und Wissenskulturen: Forschungsstand zur Revision des „finsteren Mittelalters“
- Das Zerrbild der Klostermedizin: Von der konfessionellen Polemik zur modernen Forschung
- Warum war das Bild zur Epoche der Klostermedizin so lange schief und ist es zum Teil bis heute?
- Was erzählt die Vita über Hildegard als Heilerin?
- Hildegard von Bingen, Mondfinsternis und das Eruptionscluster 1108–1110
- Presseschau zur Schafgarbe (Arzneipflanze des Jahres 2025)
- Arzneikürbis - Cucurbita pepo L., Cucurbitaceae
- Publikationen zu Autoren & Werken
- Publikationen zur Klostermedizin
- Publikationen zu Pflanzen
- Aktuelles und Termine
- Knoblauch - Allium sativum L., Alliaceae
- Andorn - Marrubium vulgare L., Lamiaceae
- Angelika - Angelica archangelica L., Apiaceae
- Apfelbeere - Aronia MEDIK., Rosaceae
- Sesam - Sesamum indicum L., Pedaliaceae
- Rosen - Rosa-Arten: Rosa gallica L., Rosa centifolia L., Rosa canina L.
- Weißdorn - Crataegus monogyna JACQ.; Crataegus laevigata (POIR.) DC.; Crataegus nigra WALDST. & KIT.
- Mariendistel - Silybum marianum (L.) GAERTNER, Asteraceae
- Lorbeer - Laurus nobilis L., Lauraceae
- Rizinus - Ricinus communis L., Euphorbiaceae
- Arnika - Arnica montana L., Asteraceae
- Ginkgo - Ginkgo biloba L., Ginkgoaceae
- Eukalyptusbaum - Eucalyptus globulus LABILL., Myrtaceae
- Schöllkraut - Chelidonium majus L., Papaveraceae
- Myrte – Myrtus communis, Myrtaceae
- Gewürzsumach - Rhus aromatica AIT., Anacardiaceae
- Borretsch - Borago officinalis L., Boraginaceae
- Keuschlamm oder Mönchspfeffer - Vitex agnus-castus L., Lamiaceae
- Schafgarbe - Achillea millefolium L., Asteraceae
- Beinwell - Symphytum officinale L., Boraginaceae
- Huflattich - Tussilago farfara L., Asteraceae
- Sägepalme - Serenoa repens (BARTR.) SMALL, Arecaceae
- Johanniskraut - Hypericum perforatum L., Hypericaceae
- Presseschau zur Blutwurz (Arzneipflanze des Jahres 2024)
- Pfefferminze - Mentha x piperita L., Lamiaceae
- Alant - Inula helenium L., Asteraceae
- Acker-Schachtelhalm oder Zinnkraut - Equisetum arvense L.
- Aus dem Alltag eines Medizinhistorikers
- Hat Hildegard von Bingen kolloidales Silber empfohlen?
- Woher bekommt man verlässliche Informationen zur Pflanzenheilkunde?
- Literatur
- Arzneipflanze des Jahres 2025: Gemeine Schafgarbe - Achillea millefolium
- Arzneipflanze des Jahres 2024: Blutwurz - Potentilla erecta
- Die Mitglieder
- “Drink before breakfast and vomit”: Zur Geschichte von Hamamelis in Amerika und Europa
- Arzneipflanze des Jahres 2023: Echter Salbei - Salvia officinalis
- Presseschau zum Echten Salbei (Arzneipflanze des Jahres 2023)
- Neues Supermittel: Weg mit Kokos, her mit Ginseng!
- Supermondfinsternis
- Presseschau zum Mönchspfeffer (Arzneipflanze des Jahres 2022)
- Arzneipflanze des Jahres 2022: Mönchspfeffer, Keuschlamm - Vitex agnus-castus
- Fasten (21): Fasten bei Hildegard von Bingen
- Goethe und das Coffein
- Presseschau zum Myrrhenbaum (Arzneipflanze des Jahres 2021)
- Impressum
- Arzneipflanze des Jahres 2021: Myrrhenbaum - Commiphora myrrha
- Deutsches Arzneibuch 6 und Ergänzungsbuch 6
- Kann man sich gegen Infektionen schützen?
- Kontakt
- Fortbildung
- Neuer Ausbildungskurs Klostermedizin und Phytotherapie
- Presseschau zum Lavendel (Arzneipflanze des Jahres 2020)
- Arzneipflanze des Jahres 2020: Echter Lavendel - Lavandula angustifolia
- Weihnachtsgewürze
- Fasten (31): Die Wurzeln des modernen Heilfastens
- Zum 838. Todestag von Hildegard von Bingen
- Presseschau zum Weißdorn (Arzneipflanze des Jahres 2019)
- Immenblatt - Weiße Taubnessel - Zitronenmelisse: Eine Verwechslungsgeschichte über Jahrtausende
- Wir hatten uns doch noch so viel vorgenommen...
- Senföle bekämpfen bakterielle Erreger auf mehreren Ebenen
- Förderung der pankreatischen Restfunktion bei EPI-Patienten durch Rizoenzyme aus Reispilzen
- Feinstaub ohne Feinsinn?
- Zur Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt
- Von tatsächlichen und angeblichen Krebsmitteln aus der Natur
- Erkältungskrankheiten umfassend therapieren: Über den Einsatz von Senfölen und Bitterstoffen
- Buchtipp: Pflanzliche Arzneimittel - was wirklich hilft
- A View to a Kill? Im Angesicht des Todes?
- Mikronährstoffe zwischen Nutzen und Risiko
- Ätherische Öle bei Lyme-Borreliose: Laborstudie deutet auf gute Wirksamkeit verschiedener pflanzlicher Öle hin
- Vorträge in Kooperation mit dem Bund Naturschutz
- Arzneipflanze des Jahres 2019: Weißdorn - Crataegus
- Zum Begriff Naturheilkunde, gängigen Strömungen und zur Abgrenzung des Begriffes
- Die Forschergruppe im ZDF ("Terra X: Drogen – Eine Weltgeschichte")
- Neue internationale Meta-Analyse bestätigt: Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich wirken natürlich gegen Krankheitserreger
- Überlebenschancen nach "alternativer" Krebsbehandlung
- Naturheilkunde in der Krebstherapie
- Themenheft Klostermedizin der "Deutschen Heilpraktiker-Zeitschrift"
- Novartis stoppt Antibiotika-Entwicklung: Pflanzliche Alternativen jetzt noch wichtiger
- Antibakterielle Wirkung von ätherischen Ölen verschiedener Lippenblütler
- Fasten: Ein wiederentdeckter Weg zu Wohlbefinden und seelischem Gleichgewicht