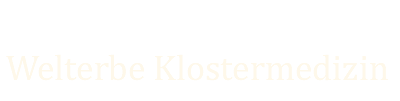Arnika - Arnica montana L., Asteraceae
Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Arnica montana so beliebt, dass die Pflanze „karrenweise aus den Mittelgebirgen in die Apotheken gebracht wurde“, wie der große Pflanzenkenner Johann Wolfgang von Goethe berichtet, der die Arnika besonders schätzte. Der Korbblütler (Asteraceae) wäre damals beinahe ausgerottet worden. Er ist auch heute noch vom Aussterben bedroht und wurde deshalb unter Naturschutz gestellt.
Im letzten Jahrzehnt ist es allerdings gelungen, die Pflanze für einen ertragreichen Feldanbau heranzuzüchten, so dass sie wieder arzneilich genutzt werden kann, ohne den Bestand zu gefährden.
Die älteste Nachricht für einen medizinischen Gebrauch der Pflanze findet sich bei Hildegard von Bingen: Unter dem Namen „Wuntwurz“ widmet sie in der Physica ein eigenes Kapitel und empfiehlt die Pflanze als Wundkraut, besonders nach Stürzen.
In der Kräuterheilkunde werden die sonnenförmigen Blüten verwendet. Sie enthalten ein komplexes Gemisch von Inhaltsstoffen (u. a. Bitterstoffe, Flavonoide und Anteile ätherischen Öls). Äußerlich angewandt können Zubereitungen aus Arnikablüten Schwellungen und Schmerzen nach stumpfen Verletzungen lindern; antimikrobielle Effekte sind vor allem aus Laboruntersuchungen bekannt.
Arnikablüten werden in der Phytotherapie äußerlich bei Prellungen, Zerrungen, Quetschungen, Verstauchungen und lokalisierter Muskelzerrung angewendet; außerdem zur Linderung lokaler Entzündungen nach Insektenstichen sowie bei kleinen Furunkeln. In der Homöopathie werden Arnica‑Präparate unabhängig davon eingesetzt.
Arnikablüten werden meist als Salben oder Gele angeboten; möglich sind auch Umschläge mit verdünnter Tinktur. Wichtig: Nicht auf verletzter Haut anwenden, nicht an Augen oder Schleimhäuten; bei bekannter Asteraceae‑Allergie meiden.
Ganz selten wurde historisch auch die Wurzel genutzt. Diese Nutzung geht auf ein Missverständnis bei Pietro Andrea Matthioli zurück, der das antike „Alisma“ fälschlich als Arnica montana deutete. Gemeint war jedoch Alisma plantago‑aquatica (Froschlöffel/Wasserfeder).
Literatur: Johannes G. Mayer, Bernhard Uehleke, Pater Kilian Saum: „Handbuch der Klosterheilkunde“, ZS-Verlag München, S. 48-49.
Johannes G. Mayer, Bernhard Uehleke, Pater Kilian Saum: „Handbuch der Klosterheilkunde“, ZS-Verlag München, S. 48-49.
Letzte Änderungen
- Der Ingwer stärkt das Gedächtnis: Zu Ingwer in der arabischen Medizin
- Yngwer vermischet in die kost ist fast gůt: Ingwer im "Gart der Gesundheit" (1485)
- Ingwer und zweimal so viel Galgant und halb so viel Zitwer: Ingwergewächse bei Hildegard von Bingen
- Presseschau zum Ingwer (Arzneipflanze des Jahres 2026)
- Ingwer ist Arzneipflanze des Jahres 2026
- Walahfrid Strabo: Leben und Werk
- Arzneipflanze des Jahres 2026: Ingwer - Zingiber officinale
- Flüsse und Blüten: Menstruation, weibliche Physiologie und sexuelle Begierde bei Trota von Salerno und Hildegard von Bingen
- Sara von Würzburg und Ortolfs Arzneibuch
- Synthese frühmittelalterlicher Medizin- und Wissenskulturen: Forschungsstand zur Revision des „finsteren Mittelalters“
- Das Zerrbild der Klostermedizin: Von der konfessionellen Polemik zur modernen Forschung
- Warum war das Bild zur Epoche der Klostermedizin so lange schief und ist es zum Teil bis heute?
- Was erzählt die Vita über Hildegard als Heilerin?
- Hildegard von Bingen, Mondfinsternis und das Eruptionscluster 1108–1110
- Presseschau zur Schafgarbe (Arzneipflanze des Jahres 2025)
- Arzneikürbis - Cucurbita pepo L., Cucurbitaceae
- Publikationen zu Autoren & Werken
- Publikationen zur Klostermedizin
- Publikationen zu Pflanzen
- Aktuelles und Termine
- Knoblauch - Allium sativum L., Alliaceae
- Andorn - Marrubium vulgare L., Lamiaceae
- Angelika - Angelica archangelica L., Apiaceae
- Apfelbeere - Aronia MEDIK., Rosaceae
- Sesam - Sesamum indicum L., Pedaliaceae
- Rosen - Rosa-Arten: Rosa gallica L., Rosa centifolia L., Rosa canina L.
- Weißdorn - Crataegus monogyna JACQ.; Crataegus laevigata (POIR.) DC.; Crataegus nigra WALDST. & KIT.
- Mariendistel - Silybum marianum (L.) GAERTNER, Asteraceae
- Lorbeer - Laurus nobilis L., Lauraceae
- Rizinus - Ricinus communis L., Euphorbiaceae
- Arnika - Arnica montana L., Asteraceae
- Ginkgo - Ginkgo biloba L., Ginkgoaceae
- Eukalyptusbaum - Eucalyptus globulus LABILL., Myrtaceae
- Schöllkraut - Chelidonium majus L., Papaveraceae
- Myrte – Myrtus communis, Myrtaceae
- Gewürzsumach - Rhus aromatica AIT., Anacardiaceae
- Borretsch - Borago officinalis L., Boraginaceae
- Keuschlamm oder Mönchspfeffer - Vitex agnus-castus L., Lamiaceae
- Schafgarbe - Achillea millefolium L., Asteraceae
- Beinwell - Symphytum officinale L., Boraginaceae
- Huflattich - Tussilago farfara L., Asteraceae
- Sägepalme - Serenoa repens (BARTR.) SMALL, Arecaceae
- Johanniskraut - Hypericum perforatum L., Hypericaceae
- Presseschau zur Blutwurz (Arzneipflanze des Jahres 2024)
- Pfefferminze - Mentha x piperita L., Lamiaceae
- Alant - Inula helenium L., Asteraceae
- Acker-Schachtelhalm oder Zinnkraut - Equisetum arvense L.
- Aus dem Alltag eines Medizinhistorikers
- Hat Hildegard von Bingen kolloidales Silber empfohlen?
- Woher bekommt man verlässliche Informationen zur Pflanzenheilkunde?
- Literatur
- Arzneipflanze des Jahres 2025: Gemeine Schafgarbe - Achillea millefolium
- Arzneipflanze des Jahres 2024: Blutwurz - Potentilla erecta
- Die Mitglieder
- “Drink before breakfast and vomit”: Zur Geschichte von Hamamelis in Amerika und Europa
- Arzneipflanze des Jahres 2023: Echter Salbei - Salvia officinalis
- Presseschau zum Echten Salbei (Arzneipflanze des Jahres 2023)
- Neues Supermittel: Weg mit Kokos, her mit Ginseng!
- Supermondfinsternis
- Presseschau zum Mönchspfeffer (Arzneipflanze des Jahres 2022)
- Arzneipflanze des Jahres 2022: Mönchspfeffer, Keuschlamm - Vitex agnus-castus
- Fasten (21): Fasten bei Hildegard von Bingen
- Goethe und das Coffein
- Presseschau zum Myrrhenbaum (Arzneipflanze des Jahres 2021)
- Impressum
- Arzneipflanze des Jahres 2021: Myrrhenbaum - Commiphora myrrha
- Deutsches Arzneibuch 6 und Ergänzungsbuch 6
- Kann man sich gegen Infektionen schützen?
- Kontakt
- Fortbildung
- Neuer Ausbildungskurs Klostermedizin und Phytotherapie
- Presseschau zum Lavendel (Arzneipflanze des Jahres 2020)
- Arzneipflanze des Jahres 2020: Echter Lavendel - Lavandula angustifolia
- Weihnachtsgewürze
- Fasten (31): Die Wurzeln des modernen Heilfastens
- Zum 838. Todestag von Hildegard von Bingen
- Presseschau zum Weißdorn (Arzneipflanze des Jahres 2019)
- Immenblatt - Weiße Taubnessel - Zitronenmelisse: Eine Verwechslungsgeschichte über Jahrtausende
- Wir hatten uns doch noch so viel vorgenommen...
- Senföle bekämpfen bakterielle Erreger auf mehreren Ebenen
- Förderung der pankreatischen Restfunktion bei EPI-Patienten durch Rizoenzyme aus Reispilzen
- Feinstaub ohne Feinsinn?
- Zur Kräuterweihe an Mariä Himmelfahrt
- Von tatsächlichen und angeblichen Krebsmitteln aus der Natur
- Erkältungskrankheiten umfassend therapieren: Über den Einsatz von Senfölen und Bitterstoffen
- Buchtipp: Pflanzliche Arzneimittel - was wirklich hilft
- A View to a Kill? Im Angesicht des Todes?
- Mikronährstoffe zwischen Nutzen und Risiko
- Ätherische Öle bei Lyme-Borreliose: Laborstudie deutet auf gute Wirksamkeit verschiedener pflanzlicher Öle hin
- Vorträge in Kooperation mit dem Bund Naturschutz
- Arzneipflanze des Jahres 2019: Weißdorn - Crataegus
- Zum Begriff Naturheilkunde, gängigen Strömungen und zur Abgrenzung des Begriffes
- Die Forschergruppe im ZDF ("Terra X: Drogen – Eine Weltgeschichte")
- Neue internationale Meta-Analyse bestätigt: Senföle aus Kapuzinerkresse und Meerrettich wirken natürlich gegen Krankheitserreger
- Überlebenschancen nach "alternativer" Krebsbehandlung
- Naturheilkunde in der Krebstherapie
- Themenheft Klostermedizin der "Deutschen Heilpraktiker-Zeitschrift"
- Novartis stoppt Antibiotika-Entwicklung: Pflanzliche Alternativen jetzt noch wichtiger
- Antibakterielle Wirkung von ätherischen Ölen verschiedener Lippenblütler
- Fasten: Ein wiederentdeckter Weg zu Wohlbefinden und seelischem Gleichgewicht